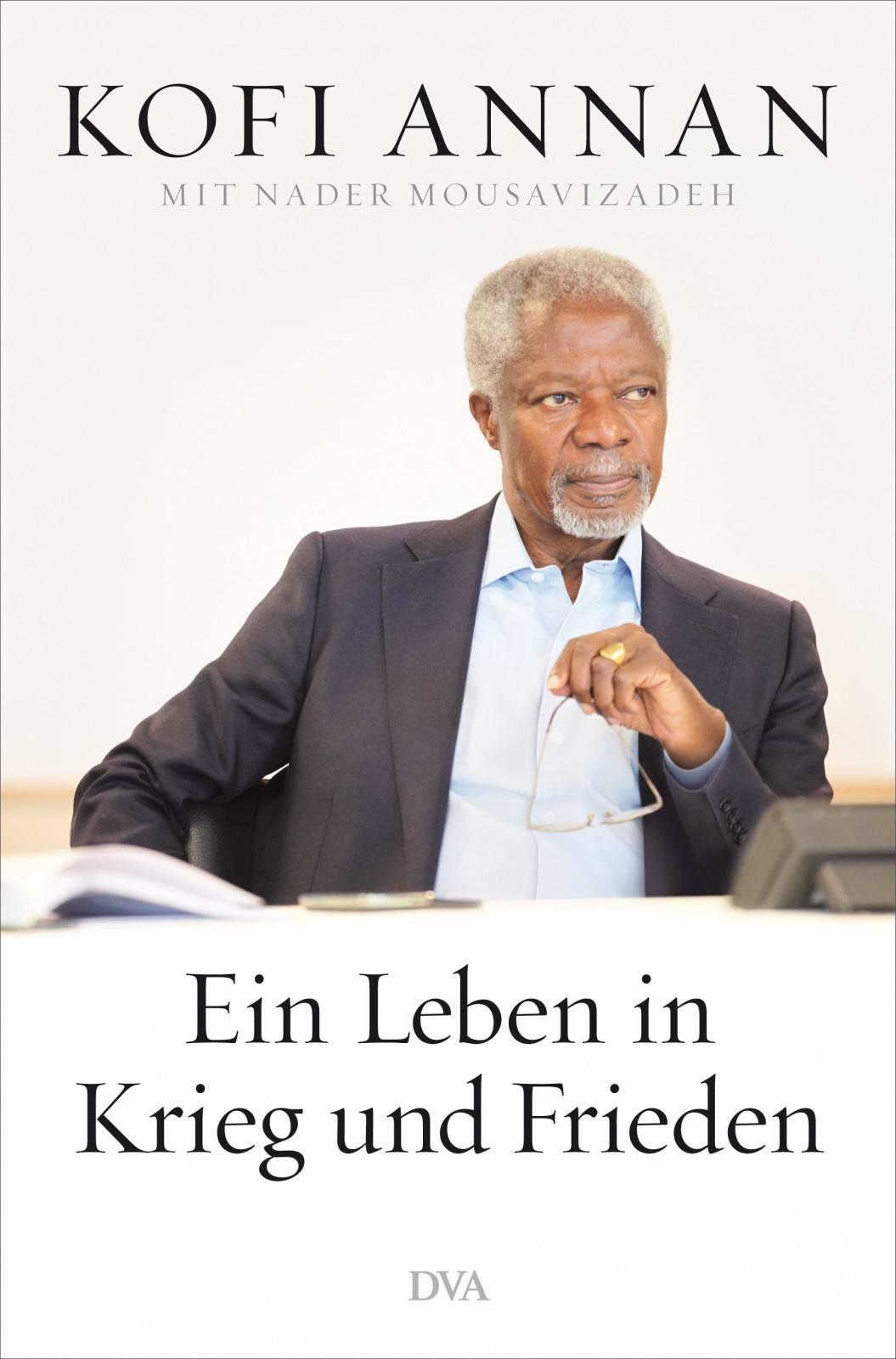![Ein Leben in Krieg und Frieden (German Edition)]()
Ein Leben in Krieg und Frieden (German Edition)
Heimatland, wo sechs Tage zuvor das von der UNO unterstützte Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden hatte, eine Orgie der Gewalt entfesselten. Gusmão warnte mich mit besorgter, aber gefasster und entschlossener Stimme, dass ein »neuer Völkermord« sein Volk bedrohe. Ich erwiderte, dass ich alles tun würde, um dem Gemetzel ein Ende zu setzen, und schloss das Gespräch mit der Bitte, er möge alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um in den kommenden Tagen seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. So wie sein Volk, das in den Straßen von Dili, der Hauptstadt Osttimors, ermordet wurde, schwebte auch er in Djakarta in Lebensgefahr.
In den vorangegangenen Wochen und Tagen hatte ich öffentlich und privat vor der zu erwartenden Gewalt im Anschluss an die Volksabstimmung gewarnt, bei der das Volk von Osttimor die langersehnte Gelegenheit bekäme, selbst über sein Schicksal zu entscheiden. In den zu der Abstimmung führenden Verhandlungen hatte ich eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu dem indonesischen Präsidenten Bacharuddin Jusuf »B. J.« Habibie aufgebaut. Habibie – in gewisser Weise ein Zufallspräsident, der ein Jahr zuvor die Nachfolge des langjährigen Landesherrn Suharto angetreten hatte – hatte mich davon überzeugt, dass er den Wunsch hatte, den Konflikt in Osttimor friedlich zu lösen.
Eine andere Frage war, ob er dazu in der Lage war. Er hatte weder seine eigenen Streitkräfte unter Kontrolle, die in der Region mit lokalen Milizen gemeinsame Sache machten, noch sagte man ihm die Wahrheit über die von ihnen verübten Morde und Brandstiftungen. Fünf Tage zuvor hatte ich ihn angerufen, um ihm mitzuteilen, wie erfreut wir darüber waren, dass die Volksabstimmung, bei der die große Mehrheit der Osttimorer ihre Stimme abgegeben hatte, unter weitgehend friedlichen Umständen stattgefunden hatte. Habibie erwiderte, seine Regierung habe »ohne schmutzige Hintergedanken« gehandelt und werde »jede Entscheidung des Volks akzeptieren und achten«. Unumwunden fügte er hinzu, dass er, sollte die Entscheidung für die Trennung ausfallen, die indonesischen Polizei- und Militärkräfte abziehen werde. Das Ergebnis der Volksabstimmung war ähnlich unmissverständlich: Rund achtzig Prozent der Teilnehmer hatten gegen die Autonomie innerhalb Indonesiens und für die volle Unabhängigkeit gestimmt.
Danach kam es in Osttimor zu grauenhaften Ereignissen, die die Entschlossenheit und Fähigkeit der Vereinten Nationen und der Weltgemeinschaft, die Herauslösung eines Territoriums aus einem großen Land zu managen, auf die Probe stellten. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit Gusmão sprach, war ich bereits zu der Schlussfolgerung gelangt, dass eine internationale Truppe nötig war, um den neuen Staat zu sichern. Aber mir war klar, dass sie nur auf Einladung der indonesischen Regierung entsandt werden konnte. Der Bemühung, diese Einladung zu erhalten, galt in den folgenden Tagen mein Hauptaugenmerk. Meine Erfahrungen mit der Friedenssicherung hatten mich gelehrt, dass man vor allem eine engagierte Führungsnation für die Interventionstruppe gewinnen musste. Noch am selben Tag, an dem Gusmão mich vor dem Ausmaß der seinem Volk drohenden Gewalt gewarnt hatte, rief ich den australischen Premierminister John Howard an. Vor dem Hintergrund der sich über das Territorium ausbreitenden Morde und Plünderungen fragte ich ihn, ob sein Land bereit sei, eine multinationale Interventionstruppe mit der Ermächtigung, die Gewalttätigkeiten zu beenden, anzuführen.
Ihm selbst und seinem Land ist es hoch anzurechnen, dass er sofort zusagte, nachdem er erklärt hatte, dass es »fünf vor zwölf« sei, wenn man eine Übereinkunft mit Habibie erreichen wolle. US -Präsident Clinton, mit dem ich später am Tag telefonierte, war in erster Linie daran gelegen, ein Mandat des Sicherheitsrats zu erhalten – schließlich handelte es sich um einen Einsatz gegen einen Hauptverbündeten der Vereinigten Staaten – und den Kongress, der die Teilnahme der USA an einer solchen Mission ablehnte, zu beschwichtigen. Die Dringlichkeit der Lage vor Ort schien ihn nicht zu beeindrucken. Das hinderte meinen Freund Richard Holbrooke, der inzwischen US -Botschafter bei den Vereinten Nationen war, nicht daran, mich zu fragen, ob dies »ein neues Srebrenica« sei. Innerhalb der amerikanischen Regierung, fügte er hinzu, sei man in der Frage, was man tun solle, auf »bosnien-ähnliche« Weise gespaltener Meinung.
Klar war jedenfalls, dass niemand – und
Weitere Kostenlose Bücher