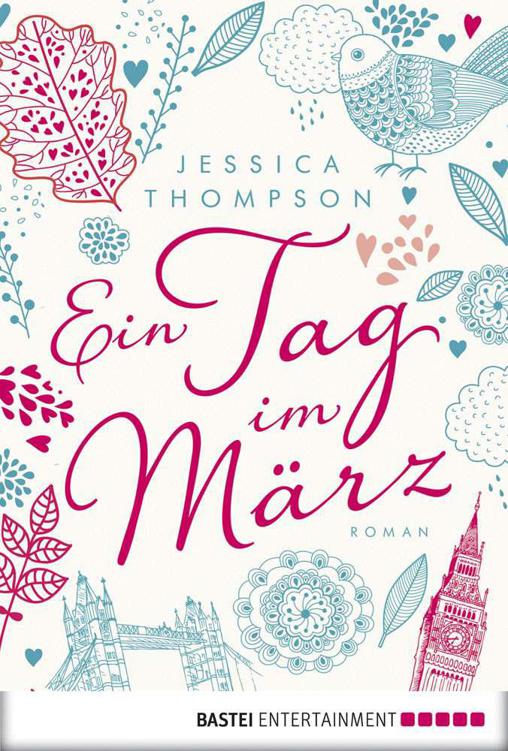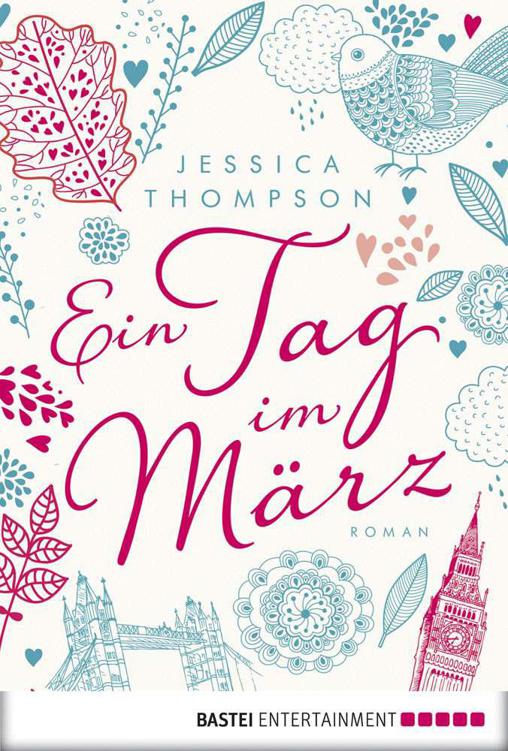
Ein Tag im Maerz
Nacken, damit sie sich darauflegen konnte. Sie verrückte sich und ließ ihren Kopf an seiner Schulter ruhen. Ben war so groß und muskulös, dass der Winkel ein bisschen unbequem war, aber sie brauchte einfach jemanden, dem sie nahe sein konnte, egal wem; Hauptsache, er gehörte irgendwie zu Max.
Während sie dort lag, erinnerte sie sich, wie ideal sie an Max’ Schulter gepasst hatte. Bryony graute vor dem Tag, an dem sie sich an den Körper von jemand anderem gewöhnen musste. DieArme um eine andere Gestalt schlingen musste. Mit den Lippen über Haut zu fahren, die niemals so süß duften würde wie Max’ Haut.
In seinem Kopf sagte Ben einige Worte zu seinem verlorenen besten Freund.
Er sagte ihm, dass er bei Bryony war und auf sie achtete. Dass sie nicht allzu viel Gewicht verloren habe und alle dafür sorgten, dass sie genug esse. Er sagte ihm, dass sie ihn mehr vermissten als alles auf der Welt und nichts mehr richtig war, seit er ihnen genommen worden war. Er sagte ihm, dass er seinen besten Freund vermisste und nicht wusste, ob er sich jemals von dem Schicksalsschlag seines Verlustes erholen würde.
»Woran denkst du?«, fragte Bryony plötzlich. Sie ließ ihre Tränen in Bens T-Shirt sickern und entschuldigte sich weder dafür, noch versuchte sie, sie zu verbergen.
»Nur an Max.« Ben hob die Hand zu Bryonys Gesicht und wischte ihr eine Träne von der Wange. Einen Augenblick lang fragte er sich, ob er ansprechen sollte, was er ihr schon so lange sagen wollte. In seinen Gebeten hatte er Max mehrmals danach gefragt, doch er schien weder seine Zustimmung noch seinen Segen zu erhalten. Und es Bryony gegenüber zu erwähnen erschien ihm immer unpassend. Er machte sich Sorgen, dass es zu den Dingen gehörte, die man zur Freundin seines verstorbenen besten Freundes niemals sagen sollte. Er wusste jedoch einfach nicht mehr, was das Richtige war. Die Sache, die er sagen wollte, sagen musste, war einfach immer da.
Deshalb sprach er immer wieder mit Max und hoffte, dass er eines Tages ein Zeichen bekam.
21
Weiße Höschen mit Grauschleier.
Montag, 25. Mai 2009
Hackney, Nordost-London
18 Uhr
»Ich finde, du begehst einen gewaltigen Fehler.«
Richards Stimme knisterte in der Leitung. Rachel drückte sich das Handy fester ans Ohr, während sie auf der roten Bank an der Bushaltestelle zur Seite rückte und einer älteren Frau Platz machte. Der Tag war mild. Die Sonne war nicht herausgekommen, aber der warme Regen der vergangenen Woche hatte aufgehört, und es gab ein kurzes Zwischenspiel mit trockenem Wetter.
Rachel blickte auf ihre schwarzen kniehohen Reitstiefel, die bequemerweise wieder in Mode gekommen waren, und kämpfte gegen die Tränen der Nervosität an, die ihr in den Augen brannten. Tränen der Angst. Zugleich spürte sie auch Wut. Richards Unfähigkeit, jemals richtig für sie da zu sein, frustrierte sie immer, und heute brauchte sie ihn wirklich. Dass er ihre Bitte in aller Seelenruhe abgewiesen hatte, trieb sie zur Raserei.
Sie merkte, dass sie kurz vor dem Explodieren war. »Pass auf!«, flüsterte sie wütend; sie wollte nicht belauscht werden. »Ich bin jetzt verdammt noch mal da. Ich habe eine Menge getan, um hierherzukommen, Rich, also könntest du mir vielleicht ein bisschen den Rücken stärken? Wo zum Teufel bist du heute eigentlich? Hättest du dir nicht ein bisschen kostbare Zeit nehmen und mich begleiten können? Nein, natürlich nicht, weil du ein selbstsüchtiger Wichser bist.«
Rachel bemerkte plötzlich, dass sie die Aufmerksamkeit der älteren Dame neben ihr erregt hatte, die leise Ts-ts machte und missbilligend ihre Dauerwelle schüttelte. Rachel krümmte sich leicht zusammen wegen ihrer Ausdrucksweise und lächelte die Dame entschuldigend an.
Ein Sattelschlepper röhrte an ihnen vorbei, dicht gefolgt von einem kleinen Motorrad, dessen Motor wie ein defekter Föhn klang. »Warte, ich … Ich kann dich nicht hören«, sagte Rachel, hielt sich das andere Ohr zu und runzelte die Stirn. »Sag das noch mal.« Sie stand rasch auf und tigerte hinter dem Wartehäuschen auf dem Pflaster mit wütender Energie auf und ab.
»Ich kann da nicht mitmachen, Rachel«, hörte sie Richards Stimme wieder deutlich. »Gut, du hast deine leibliche Mutter ausfindig gemacht, das ist schön. Aber du hast deiner Mum noch nichts gesagt. Wenn sie davon erfährt, trifft sie der Schlag«, sagte er aus der Behaglichkeit seines Stammpubs in der Stadtmitte.
»Aber … aber sie ist nicht meine Mum,
Weitere Kostenlose Bücher