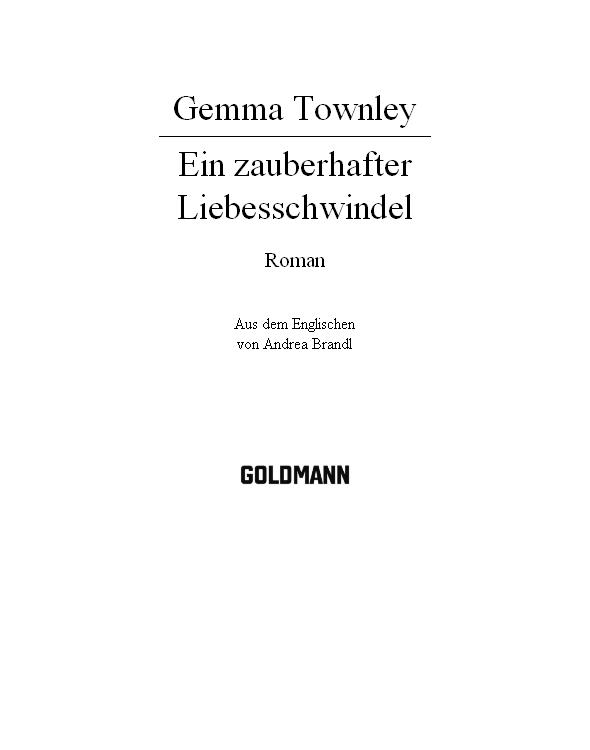![Ein zauberhafter Liebesschwindel - The Importance of being Married / 01 The Wild Trilogy]()
Ein zauberhafter Liebesschwindel - The Importance of being Married / 01 The Wild Trilogy
meinte, Sie seien sehr beschäftigt und könnten nicht kommen. Ich wollte nur sagen, wie sehr ich mich freue, dass Sie es doch geschafft haben.«
Alle Farbe wich aus meinem Gesicht. Max musterte ihn neugierig. »Hat sie das?«
»Ja, aber jetzt sind Sie ja hier. Alles andere ist unwichtig.« Mr Taylor lächelte und setzte sich wieder.
»Was war das denn?«, wisperte Max, als die Trauergemeinde zum Vaterunser anhob.
»Das?«, fragte ich mit schwacher Stimme. »Oh, das war Graces Nachlassverwalter. Mach dir um ihn keine Gedanken. Er ist ein bisschen … durch den Wind, fürchte ich. Er hat dich offenbar mit jemandem verwechselt.«
»Mit jemandem verwechselt? Mit wem denn?«
»Mit wem?«, wiederholte ich. »Tja, äh, ich bin nicht ganz sicher. Ich meine …«
»Er meinte, du hättest gedacht, ich sei zu beschäftigt, um herzukommen. Das kann er doch nicht einfach erfunden haben.«
Ich lächelte schwach. »Er … wahrscheinlich dachte er …«
- ich zermarterte mir das Gehirn nach einer passenden Antwort – »wahrscheinlich dachte er, dass du mein Freund bist.«
»Dein Freund?«
»Genau«, flüsterte ich unsicher. »Er wollte mitkommen, aber dann konnte er doch nicht. Und das habe ich Mr Taylor erzählt, deshalb dachte er wohl …«
»Du hast einen Freund?«
»Ja. Ja, ganz genau.« Ich nickte und wandte den Blick ab, während ich meinen Rote-Beete-farbenen Teint dazu zu bewegen versuchte abzuklingen.
»Oh. Klar. Tut mir leid, das wusste ich nicht.«
»Dann weißt du es jetzt.«
Das Vaterunser endete, und der Vikar ergriff wieder das
Wort. »Tja, ich sollte dann wohl besser gehen«, meinte Max und beugte sich vor, um seinen Schirm zu nehmen.
»Stimmt«, sagte ich und bemühte mich, gegen meine Enttäuschung anzukämpfen, während ich mir sagte, dass es wohl das Beste war.
»Ja. Ich meine, eine Menge Arbeit, den Termin vorbereiten, du weißt schon …«
»Klar.« Ich nickte. »Geh nur. Ich komme schon klar.«
»Gut. Tja, dann … bis später. Oder morgen. Wann auch immer.«
Er stand auf und schlich sich hinaus. Ich zwang mich, ihm nicht nachzusehen. Schließlich, so sagte ich mir, hatte dieses Gefühl der Leere in mir nichts mit Max zu tun. Sondern mit Grace. Ich war auf einer Beerdigung, Herrgott noch mal – ich sollte mich auch gefälligst leer fühlen.
»Wie schade«, sagte Mr Taylor kopfschüttelnd. »Ihr Mann musste gehen, ja? Ich hatte gehofft, ihn später richtig kennen zu lernen.«
»Ja«, sagte ich schwach. »Es ist sehr schade.« Dann wandte ich mich eilig ab. »Aber so ist er nun mal«, fuhr ich fort und zwang mich zu einem breiten Lächeln. »Er hat immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit im Kopf.«
Ich blieb nicht zu dem kleinen Umtrunk, den Mr Taylor organisiert hatte – einerseits, weil ich nicht riskieren konnte, dass er den Papierkram von Graces Testament anschleppte, andererseits aber auch, weil ich ein wenig Zeit für mich brauchte. Also ging ich im Kirchhof spazieren und schlenderte durch die umliegenden Straßen, auch wenn ich von meiner Umgebung nicht viel mitbekam.
Ich dachte ununterbrochen an das Versprechen, das ich Grace gegeben hatte, an all die Geschichten, die ich über mich und Anthony erfunden hatte. Ich fragte mich, welchen Rat sie mir jetzt geben würde, wäre sie noch am Leben. Würde sie mir raten, mein Gewissen zu erleichtern? Oder würde sie wollen, dass ich weiter log? Vielleicht waren meine Gewissensbisse ja die Strafe dafür, dass ich mich zu einem solchen Betrug hatte hinreißen lassen. Das würde jedenfalls meine Großmutter sagen. Sie würde den Kopf schütteln und sagen, ich hätte genau das bekommen, was ich verdiente.
Grace hingegen … sie hatte nicht an das Prinzip Strafe geglaubt. Sie hatte an die Menschen geglaubt, an die Liebe und an die Romantik. Sie hatte an mich geglaubt. Wann immer mich Zweifel beschlichen hatten, ob ich etwas schaffen würde oder ich in Versuchung geraten war, das Handtuch zu werfen, hatte sie mich mit ihren funkelnden Augen angesehen und mir gesagt, dass ich alles schaffen könnte, solange ich mein Ziel nur nicht aus den Augen verlöre und keine Selbstzweifel zuließe. Und sie hatte immer recht gehabt. Bei Omas Beerdigung hatte ich nicht geglaubt, dass ich es schaffen würde, eine Rede zu halten – zumindest keine, die ihr gerecht würde, keine, in der kein unterschwelliger Zorn oder Anschuldigungen mitschwangen oder der Drang, laut »Es war nicht meine Schuld, es war nicht meine Schuld« hinauszuschreien – aber genau das war
Weitere Kostenlose Bücher