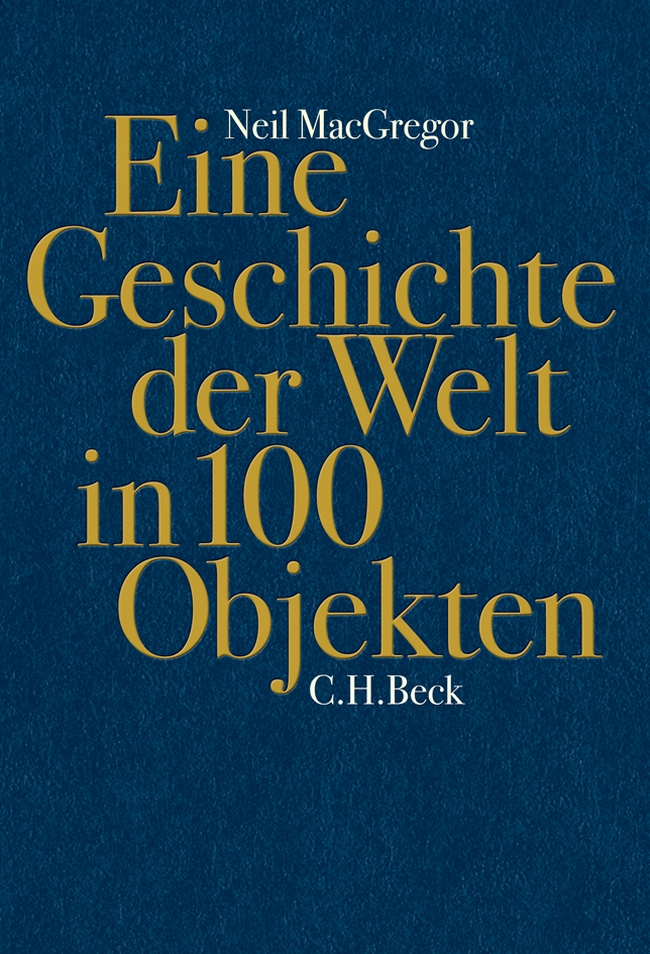![Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten]()
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten
genug davon bekommen. Man hat Kriege darum geführt, und wenn man sich römische Kochrezepte anschaut, fängt jedes so an: ‹Man nehme Pfeffer und vermenge ihn …›
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sagte ein Koch, kein anderes Gewürz könne so viele ganz verschiedene Arten von Speisen, süß wie sauer, dermaßen verfeinern. Pfeffer enthält ein Alkaloid namens Piperin, das für die Schärfe verantwortlich ist. Es fördert das Schwitzen, das den Körper kühlt – wichtig für das Wohlbefinden in heißen Klimazonen. Es unterstützt zudem die Verdauung, es regt die Geschmacksnerven an und macht den Mund wässrig.»
Der Rom am nächsten gelegene Ort, an dem tatsächlich Pfeffer wuchs, war Indien; also mussten die Römer Wege und Mittel finden, wie Schiffe über den Indischen Ozean hin und zurück fahren konnten und wie ihre Fracht dann auf dem Landweg bis in den Mittelmeerraum gelangte. Ganze Flotten und Karawanen sollten den Pfeffer von Indien bis zum Toten Meer und dann durch die Wüste zum Nil befördern. Auf Flüssen, über See und Straßen wurde er dann im Römischen Reich verteilt. Dieses riesige Handelsnetz war komplex und gefährlich, aber auch höchst profitabel. Roberta Tomber liefert ein paar Details dazu:
«Strabo berichtet im ersten nachchristlichen Jahrhundert, dass jedes Jahr 120 Schiffe den Hafen Myos Hormos am Roten Meer in Richtung Indien verließen. Aber natürlich gab es auch noch andere Häfen am Roten Meer und andere Länder, die Schiffe nach Indien schickten. Der tatsächliche Wert des Handels war enorm – einen Hinweis darauf liefert der so genannte Muziris-Papyrus aus dem 2. Jahrhundert. Darin geht es um die Kosten für eine Schiffsladung, die heute auf sieben Millionen Sesterzen geschätzt werden. Zum Vergleich: Ein Soldat in der römischen Armee verdiente rund 800 Sesterzen im Jahr.»
Einen einzigen silbernen Pfefferstreuer wie den unseren regelmäßig aufzufüllen dürfte das Haushaltsbudget ordentlich beansprucht haben, doch der Haushalt, aus dem unser Pfefferstreuer stammt, besaß noch drei weitere Behältnisse aus Silber für Pfeffer und andere Gewürze – eines hat die Form von Herkules in Aktion, zwei haben Tierform. Das ist irritierende Extravaganz. Doch die Pfefferstreuer sind nur ein kleiner Teil des riesigen Schatzes, der in Hoxne vergraben wurde. Die Kiste, die man dort fand, enthielt 78 Löffel, 20 Schöpflöffel, 29 Stück eindrucksvollen Goldschmucks und über 15.000 Gold- und Silbermünzen. Auf diesen Münzen sind 15 verschiedene Kaiser abgebildet; der letzte ist Konstantin III., der 407 an die Macht kam. Damit lässt sich der Schatz ungefähr datieren, der einige Zeit nach diesem Datum zur Sicherheit vergraben wurde – als die römische Herrschaft in der Provinz Britannia rasant zusammenbrach.
Das bringt uns zurück zu unserem Pfefferstreuer in Gestalt einer römischen Matrone von hohem Stand. Mit ihrem rechten Zeigefinger deutet sie auf eine Schriftrolle, die sie stolz in der anderen Hand hält, ein wenig wie eine Uniabsolventin, die auf dem Abschlussfoto ihr Diplom präsentiert. Das heißt, die Frau stammt nicht nur aus einer wohlhabenden Familie, sondern sie war auch gebildet. Zwar durften römische Frauen juristische oder politische Berufe nicht ausüben, doch in der Beherrschung der
artes
durften sie unterrichtet werden. Singen, Musizieren, Lesen, Schreiben und Zeichnen waren allesamt Fertigkeiten, die man von einer hochstehenden Dame erwartete. Und auch wenn eine Frau wie diese kein öffentliches Amt bekleiden durfte, so war sie doch mit Sicherheit in einer Position, im der sie über Macht verfügte.
Wir wissen nicht, wer diese Frau war, doch andere Objekte aus dem Hort erlauben Rückschlüsse: Ein goldenes Armband trägt die Inschrift UTERE FELIX DOMINA IULIANE, «Mögest du dies glücklich verwenden, Herrin Juliane». Wir werden niemals wissen, ob die Frau auf dem Pfefferstreuer diese Juliane ist, doch vielleicht gehörte er ihr zumindest. Ein weiterer Name, Aurelius Ursicinus, findet sich auf mehreren anderen Objekten – war er vielleicht Julianes Gemahl? Alle Objekte sind klein, aber äußerst wertvoll. Es handelte sich um das bewegliche Vermögen einer reichen römischen Familie – also von genau der Personengruppe, die in Gefahr ist, wenn der Staat zerfällt. In der Antike gab es keine Schweizer Nummernkonten – das Einzige, was man tun konnte, war, den Schatz zu vergrabenund darauf zu hoffen, dass man lebend zurückkam und ihn wiederfand. Doch
Weitere Kostenlose Bücher