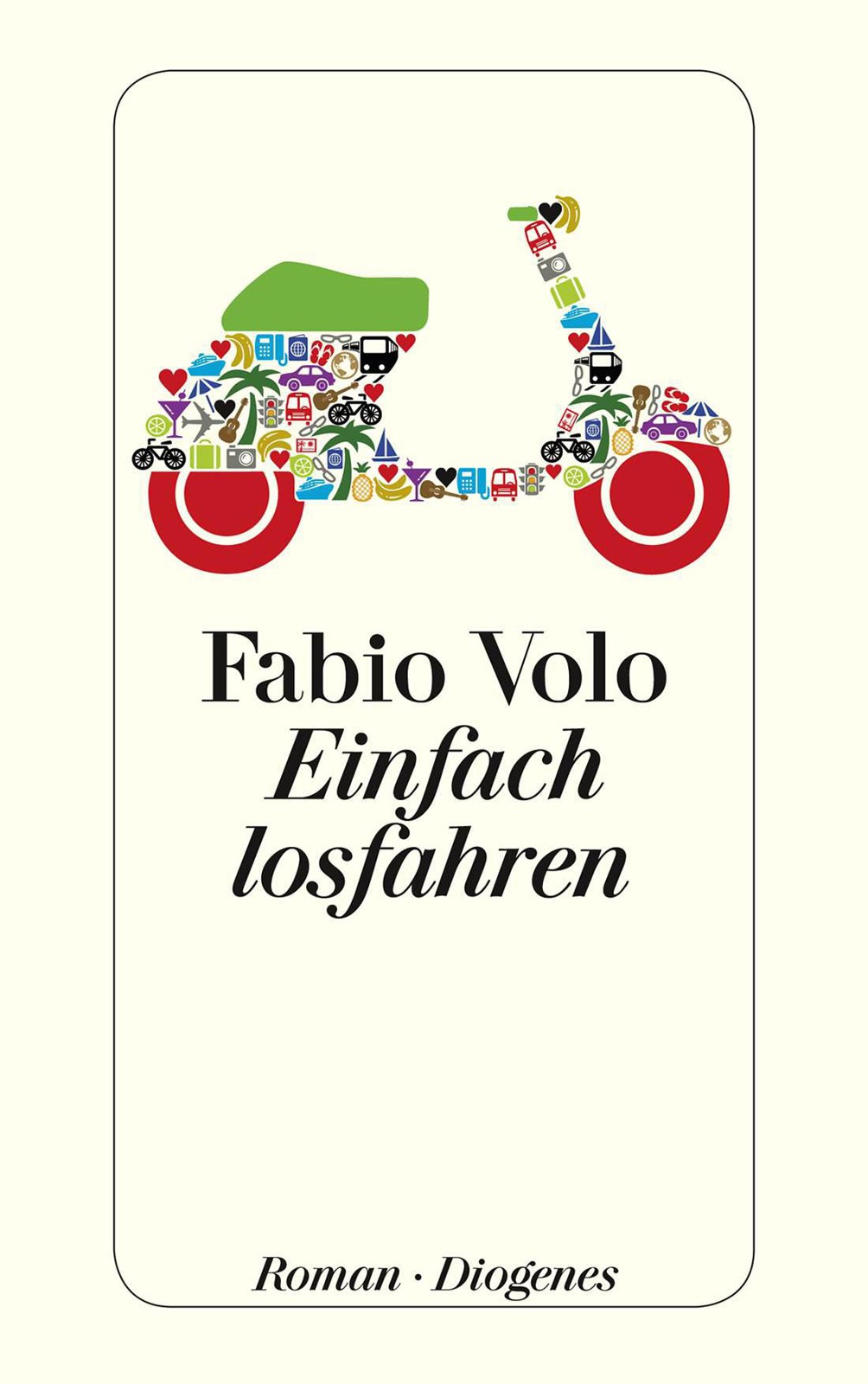![Einfach losfahren]()
Einfach losfahren
Liebeskummer zum Beispiel nicht das Recht hatten, auch nur den dicken Zeh ins große schwarze Meer des Schmerzes zu tauchen.
Mit der Zeit habe ich gelernt, jede Form des Leids zu respektieren. Auch das Leid eines Kindes, das sein Spielzeug verloren hat. Aber damals in jenem Flugzeug dachte ich, das Mädchen habe nicht das Recht dazu, so viele Tränen wegen solcher Kinkerlitzchen zu vergießen. Was war dieser Schmerz gegen den Verlust eines Menschen? Am liebsten hätte ich ihr gesagt, was ich von ihr hielt.
In dieser Zeit fühlte ich mich als Auserwählter, einer der wenigen, die wirklich das Recht hatten zu leiden. Ich hätte weinen dürfen und brachte es nicht fertig, während diese dusselige Kuh wegen irgendeines Idioten literweise wertvolle Tränen vergoss.
Wegen des starken Windes geriet die Landung ein bisschen holprig. Als die Türen des Fliegers aufgingen, spürte ich sofort die Hitze und Feuchtigkeit und roch den Duft der Natur. Eine Mischung aus Meer, Bäumen und Erde. Zu Fuß gingen wir zum Flughafenausgang, wo wir die Pässe vorzeigen mussten. Fast alle um mich herum waren Italiener. Viele hatten das Handy eingeschaltet und tauschten sich nun über den Empfang aus: »Meins geht… meins nicht… meins funktioniert…«
Ich ärgerte mich über sie. Wenn es einem nicht gutgeht, geht einem halt alles auf den Keks. Unglückliche können nicht anders, dauernd bewerten sie die anderen, kritisieren deren Benehmen und lassen an ihnen das eigene Unglück aus.
Erst hatte ich mich über das heulende Mädchen geärgert, jetzt über die Handysucht und kurz zuvor über den Applaus der Passagiere nach der Landung. Ich weiß nicht, warum, aber über dieses Geklatsche regte ich mich furchtbar auf. Mit anderen Worten: Mir ging’s echt mies.
Vor dem Flughafengebäude nahm ich ein Taxi und ließ mich zu Sophies Posada fahren. Die meisten meiner Mitflieger wurden in Minibussen zum Ferienresort gekarrt. Ich betrachtete die Frauen und hätte wetten können, dass die Hälfte von ihnen mit Afrozöpfchen zurückkommen würde.
Das Erste, was mir auffiel, als ich aus dem Taxi stieg, war der offene Container. Ich erkannte ihn sofort an seinem Inhalt, den Kloschüsseln, wieder. Die Tür zur Posada stand offen, ich trat ein und sah Arbeiter, die eine Theke installierten, vielleicht die Bar oder die Rezeption. Ich fragte nach Sophie und bekam gesagt, sie sei auf dem Dach. Ich stieg hinauf, und da stand sie, mitten unter halbnackten, mageren Männern mit verschwitzten Oberkörpern: eine strahlende Frau mit weiblicher Figur, zart, anmutig und zerbrechlich, doch zugleich mit festem Blick. Sie lächelte mich an, und ich stellte mich vor, sagte allerdings nicht, dass ich ein Freund von Federico war: »Ich heiße Michele, ich komme aus Italien und möchte dich sprechen.«
Sie gab den Arbeitern ein paar Anweisungen, dann stiegen wir vom Dach hinunter. Draußen, unter einer Holzveranda mit Strohdach, stand ein Tisch. Wir setzten uns.
Ich begriff sofort, was Federico gemeint hatte. Es war weniger ihre Schönheit, obwohl sie tatsächlich sehr schön war. Es war ihre Präsenz. In ihren Augen lag etwas Geheimnisvolles, das einen gefangen nahm.
Sie goss sich eine kalte Limonade ein, ich nahm ein Bier. Gewiss dachte sie sich schon, dass ich etwas mit Federico zu tun hatte, aber sie sagte nichts, sie wartete, bis ich anfing zu sprechen.
»Ich bin ein Freund von Federico, und ich bin hier, um dir ein Geschenk von ihm zu geben. Er hat es für dich anfertigen lassen, ist aber nicht mehr dazu gekommen, es dir selbst zu überreichen. Hier.«
Als Sophie die Kette sah, sagte sie nichts, nur der Ausdruck ihrer Augen veränderte sich. Es war, als pulsierten sie, als läge gleich dahinter ihr Herz. Sie dankte mir, zog die Kette aber nicht gleich an. Sie drehte sie in den Händen, umschloss sie, strich darüber. Sie spielte damit, als wäre es ein Mensch. Schließlich legte sie sie um.
Wir unterhielten uns ein bisschen. Nicht über Federico, sie interessierte sich vor allem für mich, wollte mich kennenlernen. Federico habe oft von mir erzählt, sagte sie, aber mehr wie von einem Bruder als von einem Freund, und vorhin auf dem Dach habe sie gleich gewusst, wer ich war.
Lange saßen wir so da. So nah beieinanderzusitzen und zu wissen, dass wir beide Federico gern gehabt hatten, gab uns wahrscheinlich das Gefühl, ihm näher zu sein, auch wenn wir nicht darüber sprachen. Wir waren beide Teil seines Lebens.
Ich blieb zum Abendessen.
Ich erklärte
Weitere Kostenlose Bücher