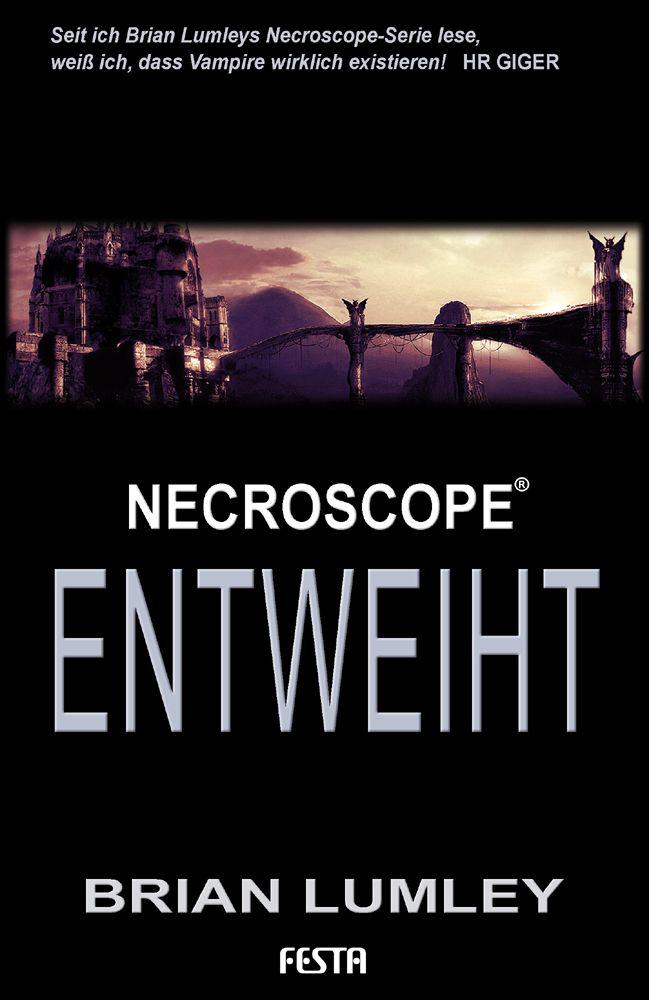![ENTWEIHT]()
ENTWEIHT
noch gar nicht kennengelernt. Und nun geh!‹
Im Durcheinander von Saras Zelle fand ich inmitten ihrer überall verstreut herumliegenden Bücher und Wandbehänge und der Trümmer ihres Bettes ihren Unterkiefer. Das Fleisch, das noch daran hing, war völlig zerfetzt, so als hätte jemand ein Tier geschlachtet und dann den Abfall weggeworfen ...«
Schwester Anna saß schaudernd unter dem Feigenbaum, die schwefelgelben Augen in der Düsternis weit aufgerissen. »Jetzt habe ich größere Angst als je zuvor!«, sagte sie. »Ich dachte, in deiner Stärke könnte ich Kraft finden, aber stattdessen überkommt mich bei deiner Geschichte ja das blanke Entsetzen. Wenn unsere Wache vorüber ist, werde ich den ganzen Tag lang zu Gott beten.«
»Der kann uns auch nicht helfen, sonst hätte Er es schon längst getan.« Delia schüttelte den Kopf. »Außerdem ist es eine Blasphemie, wenn unsereins Seinen Namen auch nur in den Mund nimmt. Nein, Er kann uns nicht helfen – das müssen wir schon selber tun. In der Küche liegen scharfe Hackbeile herum, und aus den Scheiten für das Feuerholz lassen sich kräftige Pinienpflöcke schnitzen.«
»Das ist ja alles grauenvoll!«, rief Anna, indem sie aufsprang.
Mit einem Mal war Delia auf der Hut. »Still!«, zischte sie. Sie stand ebenfalls auf und packte ihr Gegenüber am Ellenbogen. »Bleib’ im Schatten. Schau!« Damit deutete sie mit dem Kopf nach oben.
Hoch oben war zwischen den vom Mondlicht gesprenkelten Blättern des Feigenbaumes hindurch das Fenster von Vavaras Turmzimmer zu sehen. Es wurde von zwei flackernden Kerzen erhellt. Zwischen ihnen zeichnete sich ein dunkler Umriss ab, der aus blutroten, stecknadelkopfgroßen Augen lautlos in die Nacht hinausblickte!
Langsam neigte die Gestalt den Kopf nach unten, und es war, als drängte Vavaras flammender Blick geradewegs durch das Laubdach, um sich in Annas und Delias Herzen zu bohren – und vielleicht auch in ihre Gedanken. Eng zusammengekauert klammerten sich die Schwestern aneinander und wandten den Blick ab. Sie schlossen die Augen, hielten den Atem an und stellten … sogar das Denken ein. Ein, zwei, vielleicht auch drei Minuten verharrten sie so, starr vor Angst.
Als sie wieder aufzublicken wagten, war Vavara verschwunden …
London, das sind eigentlich zwei Städte – eine, die man sieht, und eine, die man nicht sehen kann. Die eine existiert, die andere existierte früher einmal und ist nun dem Vergessen anheimgefallen, der Finsternis, die zweitausend Jahre menschlicher Besiedlung mit sich bringen, all die Bauwerke, Brücken, Gewölbe, die untertunnelten Wasserläufe, Keller und Schutzräume, ein regelrechtes Labyrinth aus Transportwegen und Kommunikationsnetzen. Das unterirdische London ist zwar immer noch ein Teil Londons, dennoch ist es eine andere, von Menschenhand abgesonderte Welt.
In dieser unterirdischen Stadt erstrecken sich meilenweit Abwasserkanäle, die einstmals tiefe Gräben waren, Süßwasser führende Bäche und reißende Flüsse. Es gibt kilometerlange, niedrige Durchgänge und nicht mehr begehbare Pfade, die einst Landstraßen und deren Seitenwege waren, und längst aufgegebene oder nie fertiggestellte Grabensysteme, durch die sich nun nur noch Aale winden, in denen Ratten quieken, Frösche quaken und vollkommen lautlos bleiche, wild aufgeschossene Pilze wuchern … und wer weiß, was sonst noch alles herumkriecht?
Auch Menschen gibt es dort unten. Kanalarbeiter – die Flusher.
An der Oberwelt werden zehn Millionen Toiletten gespült, die meisten davon mehrmals täglich, und tief unter der Asphaltdecke der Stadt werden die Flusher dafür bezahlt, dass sie unten beseitigen, was oben weggespült wurde. Darin besteht ihre Arbeit; das ist, was sie tun. Sie sind die in der Kanalisation hausenden Antikörper der Metropole. Tagaus, tagein schrubben sie die zu Schotter zerfallenden Ziegelsteine und Stahlbetonwände der vielfach verschlungenen Adern der Großstadt, sorgen dafür, dass nichts verstopft und alles fließt, halten die lebensnotwendigen Arterien frei und entfernen die sich dort ansammelnden Ablagerungen. Andernfalls würde die Stadt im Unrat ersticken und Seuchenherde würden aufkeimen.
So würde es vielleicht ein Dichter sehen. Der Standpunkt eines Flushers hingegen ist weit simpler: Er schaufelt Scheiße.
Wallace Fovargue war Flusher gewesen, wäre es immer noch liebend gerne, wenn sein ehemaliger Vorarbeiter und die Kollegen ihn nur haben wollten. Aber sie wollten ihn nicht, ebenso
Weitere Kostenlose Bücher