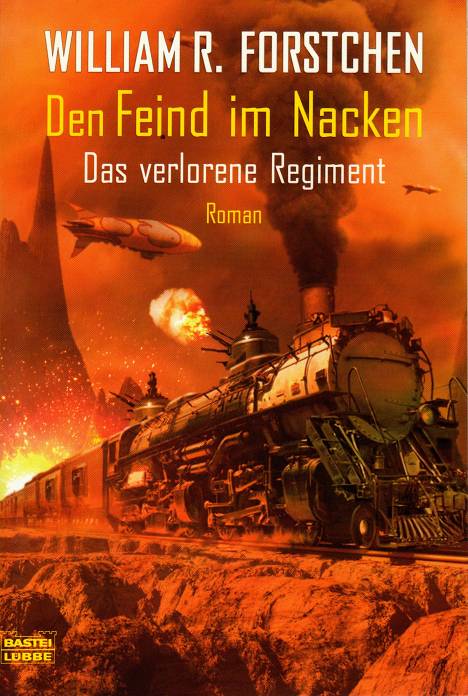![Forstchen, William R. - Das verlorene Regiment Bd. 4 - Den Feind im Nacken]()
Forstchen, William R. - Das verlorene Regiment Bd. 4 - Den Feind im Nacken
es wieder geschafft!«, rief Marcus.
Wie betäubt sackte Andrew auf dem Sattel nach vorn.
Er hatte gedacht, es sei bereits alles zu Ende, hatte ein nüchternes Gefühl der Erlösung einsetzen gespürt, als bliebe nun nur noch zu sterben. Und doch ging es immer noch weiter, eine weitere Abwehr im allerletzten Moment. Er fühlte sich völlig verbraucht. Die Anspannung der beiden letzten, verzweifelten Tage hatte sich tief in seine Seele gefressen, tiefer denn je zuvor. Er saß da und beobachtete das Geschehen, ohne es wirklich wahrzunehmen, als Marcus’ Soldaten den Angriff der Merki auflösten und die Überlebenden in die Flucht vor der Front schlugen.
Vincent saß zusammengesunken in der Ecke der Kabine neben dem toten Lokomotivführer und Heizer. Draußen hörte er heisere Triumphschreie, das Kreischen verwundeter Tiere, kehliges Schmerzensgebrüll; doch das Tosen der Schlacht selbst verebbte.
»Dachte, wir hätten gewonnen«, stieß der Merki zwischen qualvollem Keuchen hervor. Mittlerweile strömte ihm Blut aus dem Mund und troff auf den Eisenboden der Kabine.
»Du sprichst Rus«, stellte Vincent flüsternd fest.
»Rus-Schoßtier als Kind, treu, gut.«
Der Merki hustete und verkrümmte sich unter einem Krampf.
»Töte mich, beende das.«
Eine dunkle Erinnerung überkam ihn; der sterbend am Kreuz hängende Merki. Er schaute zum Revolver in der Ecke der Kabine hinüber. Die Waffe war leer geschossen. Mit dem Schwert in der Hand begab er sich auf die Knie, und der Merki nickte.
»Warte.« Abermals hustete er. »Väter, seht mich nun, nehmt meinen Geist an, vergebt mir meine Sünden, lasst mich neben euch durch den ewigen Himmel reiten und gewährt mir die Macht, meine Frau und meine Söhne zu beschützen, obwohl ich nicht mehr da bin.«
Vincent musterte den Merki verblüfft.
»Das sind unsere Worte zum Tod.« Der Merki grinste, als er die Bestürzung in Vincents Zügen erkannte. »Und jetzt töte mich, Vieh.«
»Wir sind kein Vieh«, zischte Vincent. »Wir sind Menschen.«
»Vielleicht hast du recht, trotzdem sterbe ich voll Hass auf euch für das, was ihr uns angetan habt.«
»Und was ihr mir angetan habt!«, schrie Vincent, beugte sich vor und trieb das Schwert in die Kehle des Merki.
Ein Krampf durchzuckte den Leib, Blut spritzte Vincent ins Gesicht.
Der Merki sah ihn weiter an und schien beinah zu lächeln. Dann verebbte sein Atem, während das Blut sich zu einer riesigen Pfütze um ihn sammelte. Seine Augen standen nach wie vor offen.
Vincent Hawthorne ließ sich gegen die gegenüberliegende Kabinenseite plumpsen und starrte den Merki an.
Und was wir einander angetan haben, dachte er.
Meine Frau, meine Söhne zu beschützen, obwohl ich nicht mehr da bin.
Tanya, der kleine Andrew, die Zwillinge. Was tun wir einander bloß an?
Plötzlich schwappte alles über ihm zusammen. Die winzige Kabine bildete in diesem Augenblick sein gesamtes Universum, mit dem toten Lokomotivführer, der das Symbol eines alten Freundes an die Brust gedrückt hielt, dem Heizer daneben, dem toten Merki an der Tür, dem Blut aller drei, das zusammenfloss, den verhallenden Geräuschen der Schlacht draußen, der einsetzenden Dunkelheit und dem alles überlagernden, durchdringenden Gestank des Todes, der schwer in der Luft hing.
Mit zitternden Schultern beugte er sich vor.
O mein Gott, was bin ich geworden? Was tue ich? Bin ich jetzt wirklich wie sie?
Gott steh mir bei.
Ein Schluchzen begann, seinen Körper zu durchlaufen; er schluchzte, wie er es seit seiner Kindheit nicht mehr getan hatte, einer Zeit, von der er tief in seinem Herzen wusste, dass sie noch nicht so lange zurücklag.
Er hörte, wie sich jemand näherte, doch ihn kümmerte nichts mehr. Mit in den Händen vergrabenem Gesicht weinte er; die frischen Tränen vermengten sich mit dem Blut, wuschen es weg.
Dann spürte er einen Arm, der sich um seine Schulter schlang.
»Gut so, Sohn. Lass es raus, wein es heraus.«
Es war Marcus.
Er lehnte sich an die Schulter des alten Soldaten und weinte hemmungslos, während sein Freund ihn festhielt.
Wenn ein Feldkommando das verheißt, dachte Chuck missmutig, dann kann ich darauf verzichten. Er kroch vorwärts, steckte den Kopf in eine Pfütze schlammigen Wassers und trank gierig. Er hörte einen Zweig knacken.
Ruckartig schnellte er hoch, rollte sich zur Seite, hob den Karabiner an und drückte den Abzug.
Die Kammer war leer.
Hinter ihm krachte eine Flinte; der Merki krümmte sich und landete platschend im
Weitere Kostenlose Bücher