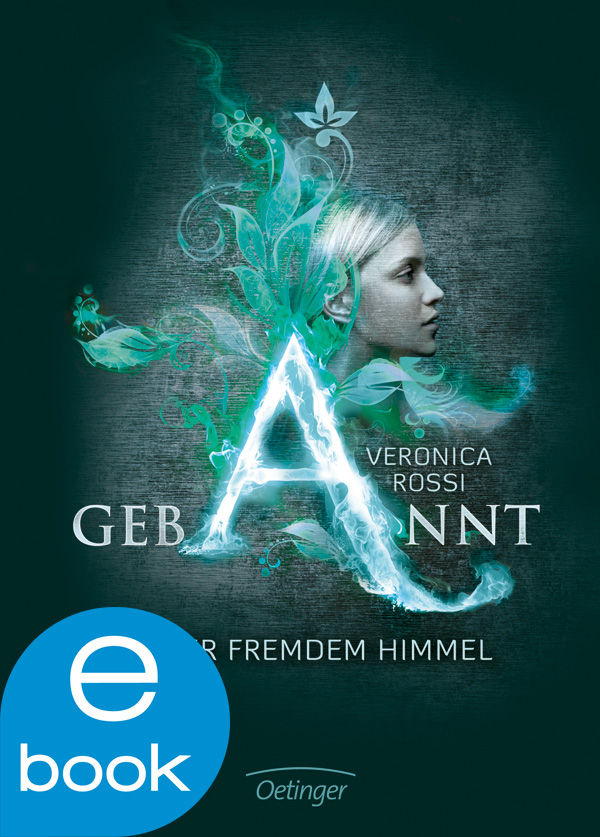![Gebannt - Unter Fremdem Himmel]()
Gebannt - Unter Fremdem Himmel
Fußsohlen. Wie aufs Stichwort blies ihr Anzug in diesem Moment einen Schwall kühle Luft über ihren Rücken und ihren Bauch. Fast hätte Aria gelacht. Der Medi-Anzug versuchte noch immer, ihre Temperatur zu regulieren.
Sie schaute auf. Dichte, graue Wolken verdunkelten den Himmel. Dazwischen konnte sie Äther erkennen. Echten Äther. Seine Ströme verliefen über den Wolkengebirgen. Sie waren wunderschön, wie Blitze, die in einer Flüssigkeit gefangen waren: zuweilen dünn wie Schleier, dann wieder dicke, hell leuchtende Wogen. Der Äther wirkte überhaupt nicht wie eine Gefahr, die der Welt ein Ende bereiten konnte, doch genau das war während der Einheit beinahe geschehen.
Sechs Jahrzehnte lang hatte der Äther die Erde mit fortwährendem Feuer versengt. Doch die eigentliche Gefahr für die Menschheit hatte in den Mutationen bestanden, den Gen-Veränderungen, die er herbeiführte. Rasch hatten sich neue Krankheiten entwickelt und dazu geführt, dass ganze Völker von den Seuchen ausgelöscht wurden. Arias Vorfahren hatten zu den Glücklichen gezählt, die in den Biosphären Zuflucht gesucht und dort Schutz gefunden hatten.
Schutz, über den sie nun nicht mehr verfügte.
Aria wusste, dass sie in dieser kontaminierten Welt nicht überleben konnte. Dafür war sie nicht geschaffen. Ihr Tod war nur eine Frage der Zeit.
Nach einer Weile entdeckte sie eine hellere Stelle in der Wolkendecke, durch die ein goldener Schein schimmerte. Dieses Licht stammte von der Sonne. Vielleicht würde sie die echte Sonne zu sehen bekommen. Beim Gedanken an den Anblick der Sonne musste sie sich zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. Denn wer würde jemals davon erfahren? Wem würde sie erzählen können, dass sie etwas so Unglaubliches gesehen hatte?
Aria richtete sich auf und steuerte auf die Stelle zu, an der die Hovercrafts verschwunden waren – wohl wissend, dass es sinnlos war. Glaubte sie etwa, Konsul Hess würde seine Meinung ändern? Aber wohin sonst sollte sie sich wenden? Sie stakste auf Füßen, die nicht ihr zu gehören schienen, über Erde, die mit einem netzartigen Muster wie von einem Giraffenfell überzogen war.
Kaum hatte sie ein Dutzend Schritte zurückgelegt, als sie auch schon erneut husten musste. Wenig später war ihr so schwindlig, dass sie nicht länger aufrecht stehen konnte. Aber es waren nicht nur ihre Lungen, die die Außenwelt nicht vertrugen: Auch ihre Augen tränten, und ihr lief die Nase. Ihre Kehle brannte, und ihr Mund füllte sich mit heißem Speichel.
Wie jeder andere hatte auch sie die Geschichten über die Todeszone gehört: Hier gab es eine Million Möglichkeiten, sein Leben zu verlieren. Sie wusste von den Wolfsrudeln, die so gerissen waren wie Menschen. Sie kannte die Berichte von den Krähenschwärmen, die Menschen bei lebendigem Leib zerhackten, und von Ätherstürmen, die zuschlugen wie Raubtiere. Aber die schlimmste Todesart in der Todeszone musste darin bestehen, allein zu verrotten.
Peregrine | Kapitel Acht
Perry stand vor dem Kochhaus und sah, wie sein älterer Bruder auf die Lichtung zuging. Dort angekommen, hielt Vale inne und hob den Kopf, um die Gerüche wahrzunehmen, die der Wind mit sich trug. In der Hand hielt er das Hirschgeweih – ein gewaltiges Gewirr aus Horn, so dick wie ein kleiner Baum. Es war beeindruckend, das konnte Perry nicht bestreiten. Vale warf einen prüfenden Blick über die Menge und entdeckte zuerst Perry, dann Talon an seiner Seite.
Während sein Bruder auf sie zukam, wurde Perry sich plötzlich vieler Dinge unangenehm bewusst: Die Augenklappe des Siedlermädchens und der Apfel, beides in Plastikfolie gewickelt und tief in seinem Umhängebeutel versteckt. Das Messer an seiner Hüfte. Sein Bogen und Köcher auf seinem Rücken. Er bemerkte, wie die Menschenmenge stiller wurde und einen Kreis um ihn bildete. Er spürte, wie Talon sich an seiner Seite unruhig bewegte, dann langsam zurückzog. Und er nahm Stimmungen wahr – Dutzende von erwartungsvoll gespannten Gerüchen, die die Luft genauso erfüllten wie der Äther über ihnen.
»Hallo, mein Junge«, begrüßte Vale Talon sorgenvoll. Perry konnte es ihm an den Augen ansehen. Und er bemerkte auch die Schwellung um Vales Nase, fragte sich allerdings, ob sie noch jemand anderem auffallen würde.
Statt einer Antwort hob Talon die Hand, blieb aber weiter im Hintergrund. Vor seinem Vater wollte er keine Schwäche zeigen und auch nicht, wie verletzt er war – durch Kummer und
Weitere Kostenlose Bücher