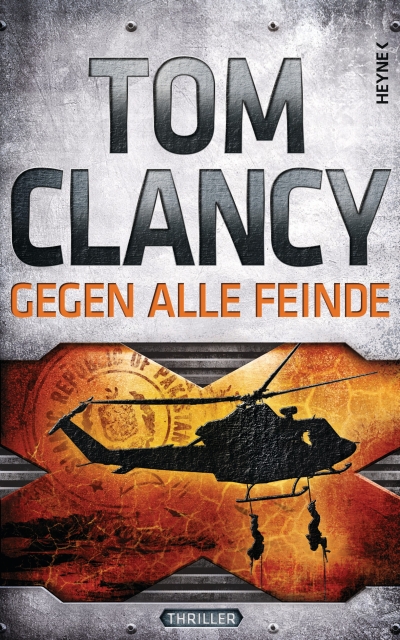![Gegen alle Feinde - Clancy, T: Gegen alle Feinde - Against All Enemies]()
Gegen alle Feinde - Clancy, T: Gegen alle Feinde - Against All Enemies
hinein. Er empfand einfach nur den Schmerz eines Vaters, der mit dem Flüggewerden seines Sohnes fertigwerden musste. Das war alles. Auch in diesem Fall musste die Logik über die Gefühle siegen. Aber das war leichter gesagt als getan. Wenn er die beiden beobachtete und sie so jung und lebendig und wunderschön aussahen, musste er immer an sich und Sofía denken. Natürlich war er eifersüchtig, eifersüchtig auf die Jugend seines Sohnes und die Tatsache, dass er eine Frau gefunden hatte, die er liebte, während Rojas die Liebe seines Lebens verloren hatte. Waren solche Gefühle akzeptabel? Den eigenen Sohn zu beneiden?
Auf der anderen Seite der Kabine saß Jeffrey Campbell, ein alter Studienfreund aus seiner Zeit an der Universität von Südkalifornien, der danach Betatest ge gründet hatte, ein Unternehmen, das Zulieferteile für die Handyproduktion herstellte. Campbell hatte viele Millio nen verdient und dehnte jetzt seine Geschäftstätigkeit mit Rojas’ Hilfe auf Südamerika aus. Beide hatten in der Baseballmannschaft ihrer Uni gespielt und waren einmal sogar zur selben Zeit mit zwei Zwillingsschwestern liiert gewesen, was auf dem Campus ziemliches Aufsehen erregte, weil die jungen Damen zuvor von Legionen anderer Studenten angehimmelt worden waren.
»Du siehst aus, als ob du eine Million Kilometer von hier entfernt wärst«, sagte Campbell.
Rojas lächelte schwach. »Nicht ganz eine Million. Und wie geht es dir?«
»Es geht so. Ich habe immer gedacht, dass ich vor ihm diese Welt verlassen würde. Es ist nicht leicht, seinen jüngeren Bruder zu begraben.«
Der letzte Satz versetzte Rojas einen Stich. »Natürlich nicht.«
Campbells Bruder, ebenfalls ein ehemaliger College-Sportler, der in seinem Leben nie auch nur eine einzige Zigarette geraucht hatte, war ganz plötzlich an Lungenkrebs gestorben. Dabei war er erst achtunddreißig Jahre alt gewesen. Die Ärzte vermuteten, er sei abgereichertem Uran ausgesetzt gewesen, als sein M 1 A 1 -Abrams-Pan zer im Irak auf eine improvisierte Bombe auffuhr. Allerdings würde es schwierig sein, dies zu beweisen und vom Militär eine Entschädigungszahlung zu bekommen.
Rojas’ älterer Bruder war gestorben, als er erst siebzehn und Rojas fünfzehn Jahre alt war. Sie waren in Apatzingán, einer damals noch viel kleineren Stadt im Staat Michoacán in Südwestmexiko, aufgewachsen. Ihr Vater war ein Bauer und Viehzüchter, der an den Wochenenden Landwirtschaftsgeräte und die Taxis eines örtlichen Transportunternehmens reparierte. Er war ein breitschultriger Mann mit einem dicken Schnurrbart und einem hellbraunen Filzhut, von dem viele Leute behaupteten, er trage ihn auch nachts im Bett. Ihre Mutter, die Rojas mit ihren großen braunen Augen und dichten Brauen auf eine Weise ansehen konnte, dass es ihm kalt und heiß über den Rücken lief, schuf tete endlos auf dem Bauernhof und hielt gleichzei tig ihr Heim tadellos in Ordnung. Seine Eltern hatten ihm ein Arbeitsethos eingepflanzt, das ihm keine Zerstreuungen erlaubte. Er hatte auch wenig Verständnis und Geduld für all jene, die leicht und locker durch das Leben surften.
Die Nacht war kalt und klar, der Wind wehte von den Bergen herunter und ließ das Grundstückstor, dessen Riegel längst weggerostet war, hin- und herschwingen. Im Gegenlicht des abnehmenden Mondes standen die drei Gangster da und warteten darauf, dass Rojas’ Bruder Esteban herauskam und sich ihnen stellte. Sie waren dunkel gekleidet. Zwei von ihnen sahen mit ihren Kapuzen wie der leibhaftige Sensenmann aus. Der Größte wartete etwas weiter hinten, wie ein Wächter, der alle Geschehnisse für ein Auge beobachten sollte, das mächtiger war als er.
Rojas trat auf die Veranda hinaus und fasste seinen Bruder am Handgelenk. »Gib es ihnen einfach zurück!«
»Ich kann nicht«, sagte Esteban. »Ich habe es bereits ausgegeben.«
»Wofür?«
»Für die Reparatur des Traktors und der Wasserrohre.«
»Und du hast das Geld auf diese Weise bekommen?«
»Ja.«
»Warum hast du das getan?« Rojas’ Stimme wurde brüchig.
»Warum? Schau uns doch an! Wir sind Bauern! Wir arbeiten den ganzen Tag, und wofür? Für fast nichts! Die arbeiten für das Kartell, und in fünf Minuten verdienen sie so viel wie wir in einem ganzen Monat! Das ist nicht fair!«
»Ich weiß, trotzdem hättest du es nicht tun dürfen!«
»Okay, du hast recht. Ich hätte ihr Geld nicht stehlen sollen, aber ich habe es getan. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt muss ich mit ihnen reden.
Weitere Kostenlose Bücher