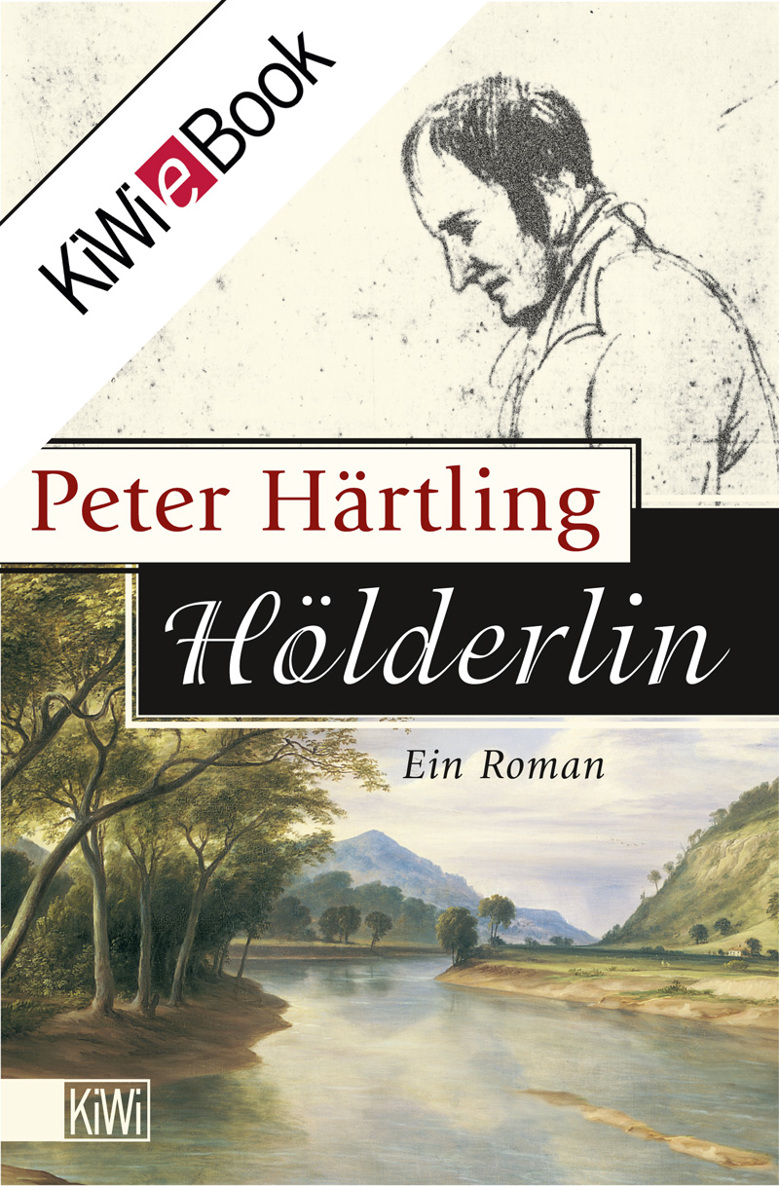![Härtling, Peter]()
Härtling, Peter
hatte Neuffer viel und ausschmückend erzählt. Ihretwegen nannte er sich manchmal »der Pelargide« und wurde auch von den Stiftlern, allerdings eherspöttisch, so gerufen. Sie war eine geborene Pelargos, stammte aus einer Familie griechischer Flüchtlinge, die vor der türkischen Gewaltherrschaft geflohen war und sich in Stuttgart angesiedelt hatte.
Der Besuch bei Schubart hatte ihn angestrengt. Sie hatten danach in einem Gasthof etwas gegessen, getrunken und waren erschöpft sitzen geblieben. Selbst Neuffer, der nur sah, was er sehen wollte, war bestürzt über die schreckliche Hinfälligkeit Schubarts.
Sie kamen ins Haus, als es schon dämmerte. Er hatte kaum Zeit, sich auf seinem Zimmer Gesicht und Hände zu waschen, die Kleidung in Ordnung zu bringen, als ihn Neuffer schon holte. Sie würden zum Abendessen erwartet, und der Vater dulde keine Verzögerungen im Tagesablauf. Das war Hölderlin nicht gewöhnt.
Man ging gleich zu Tisch. Die »Freunde des Hauses« waren zwei ältere Ehepaare, ohne Zweifel von Ansehen in der Stuttgarter Gesellschaft. Er wurde von allen neugierig abgeschätzt; wahrscheinlich hatte Neuffer in seiner Ankündigung übertrieben. Er saß zur Linken der Hausherrin. Mit Neuffers Vater hatte er einige Wort gewechselt, man war steif und gehemmt geblieben, auch die andern trugen nicht zur Belebung der Unterhaltung bei. Nur Neuffer ereiferte sich und wurde mehrfach mit Blicken von seinem Vater zurechtgewiesen.
Die »Griechin« gefiel ihm. Als Mädchen mußte sie zierlich gewesen sein, nun war sie fülliger und in den Gesten behäbiger. Dennoch hatte sie sich die Grazie bewahrt. Ihre dunkelbraunen, ganz rund geschnittenen Augen, konnten, wenn sie ein Gespräch fesselte, wunderbar glühen.
Er hatte sich, noch während er die Dame zu Tisch führte,überlegt, wie er das Gespräch einleiten solle. Dazu kam es nicht, denn Frau Neuffer fragte ihn gleich nach Tübingen, nach den Zuständen am Stift, was er von dem Ephorus Schnurrer halte und von den anderen Professoren, zum Beispiel Bök, über den man sich hier ziemlich lustig mache, wie denn der Ludwig sich schlage und wie vorteilhaft sie es finde, daß die Poeten sich verbündet hätten – sie sprach ohne jeglichen Akzent, eher schwäbisch eingefärbt, und darum unterbrach er sie, sie möge seine Neugier entschuldigen, ob sie denn noch Griechisch könne?
Aber natürlich! Wollen Sie’s hören? Sie redete ein paar Sätze und fügte rasch, seinen Einwand vorausahnend hinzu: Jetzt wollen Sie, wie der Ludwig, sagen, daß dies nicht Ihr Griechisch sei.
Er nickte, nur weniges habe er verstanden.
Wir sind aber Griechen, erwiderte sie.
Er bat sie, von der verlorenen Heimat zu erzählen.
In dem Moment hob der alte Neuffer die Tafel auf: Mir scheint, meine liebe Frau ist von unserem jungen Gast wieder einmal aufs Griechenthema gebracht worden. Ich schlage vor, die beiden in einer Ecke des Salons für sich zu lassen, denn uns sind diese Geschichten geläufig, nicht wahr?
Ludwig jedoch bestand darauf zuzuhören. Er sei, wenn die Mutter von Griechenland erzähle, unersättlich, und sie langweile ihn nicht.
Es gefiel ihr, die Aufmerksamkeit der beiden jungen Männer zu haben; die Freude machte sie jung.
Sie berichtete umständlich, hielt sich an Kleinigkeiten fest, von der für die Schwaben exotischen Kleidung, daß man dort Weinblätter esse, was sich die Weingärtner hier gar nicht vorstellen könnten, die Blätter seien doch zunichts nutze, als den Trauben Schatten zu geben; und daß dort nur die Männer miteinander tanzten und daß es Instrumente gebe, die für die hiesigen Ohren Katzenmusik machten.
Und die Tempel der Götter? fragte er.
Die finde man überall, auf den Bergen und in den Hainen, im Land und am Meer.
Wenn sie sagte: am Meer, mußte er sich das Meer ausdenken, er hatte es nie gesehen, und eben erst hatte er über Kolumbus gelesen, seine endlose Reise und die Ankunft auf einem neuen Kontinent; er sah eine bewegte Wasserfläche, Schiffe darauf, die Luft dem Wasser gleich und einen endlosen, milden Horizont. Sie sagte: Manches ist so wie anderswo, nicht vieles, und nirgendwo ist das Licht wie bei uns in Griechenland.
Das Licht? Sie meinen die Sonne? Das Tageslicht, die Helligkeit.
Ja, das meine ich für euch, und doch etwas anderes.
Ich kann mir’s denken, sagte er leise.
Wirklich? antwortete sie ihm, ich glaube, man muß es gesehen, es muß einen umgeben haben.
Das ist ein Licht, das man spürt.
Sie sagen es so, als wären
Weitere Kostenlose Bücher