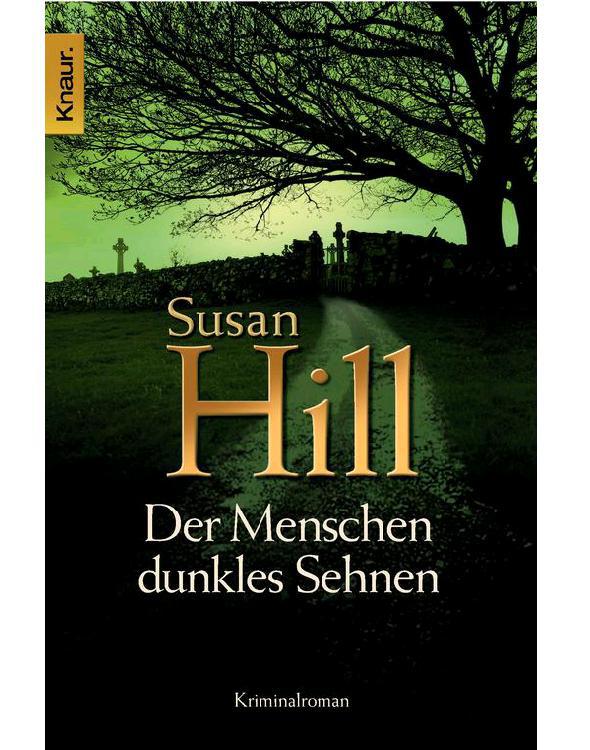![Hill, Susan]()
Hill, Susan
Tisch in einer Fensternische geführt wurden. »Schauen Sie, die Kerzen stehen tatsächlich noch in Chiantiflaschen mit Strohkörben.«
»Ich hoffe, es gibt gute Nachspeisen.«
»Mit jeder Menge Sahne.« Die Speisekarten wurden gebracht, Spezialitäten des Tages liebevoll von einem Kellner mit der Art italienischem Akzent beschrieben, über den die Leute gerne witzeln. »Der Unterschied ist, dass das Essen fantastisch schmeckt. Sie haben zwar Krabbencocktail auf der Karte, aber die Krabben sind frisch, in köstlicher hausgemachter Mayonnaise, und das Kalbfleisch ist papierdünn, und die Leber zergeht einem auf der Zunge.«
»So sollte es sein.«
Eine Flasche Chianti wurde gebracht und eingeschenkt, rubinrot, in große Gläser.
»Und auch das richtige Getränk.« Simon hob sein Glas und lächelte, dieses verheerende, außergewöhnliche Lächeln. Das Restaurant war voll, aber es war niemand sonst im Raum, in Lafferton, auf der Welt. Das ist Glück, dachte Freya, das, jetzt. Vielleicht habe ich bis heute Abend nicht gewusst, was Glück ist.
Und dann unterhielten sie sich, wie sie sich an jenem Abend in seiner Wohnung unterhalten hatten, füllten mehr von den Lücken, die sie damals offen gelassen hatten, entdeckten mehr über ihr jeweiliges Leben, sprachen über Simons letzte Reise nach Italien und die Vorbereitungen für seine nächste Ausstellung, ein bisschen über den Chor – aber er sang nicht, war nicht an Musik interessiert, mochte die Stille; über Kricket, das er beim Polizeiverein von Lafferton spielte und auch im Dorf seiner Mutter; erneut über seine Kindheit, die er, wie Freya fand, sich selbst nach wie vor genauso zu erklären versuchte wie ihr; darüber, dass er ein Drilling war und es ihn mehr zu faszinieren als zu irritieren schien, der Außenstehende der drei zu sein. Sie gingen zu Freyas Kindheit über, der Metropolitan Police und dann zu ihrer Ehe, über die sie beim letzten Mal rasch hinweggeglitten war; das war wie Simons Kindheit – sie musste versuchen, es zu begreifen und sich selbst zu erklären, und während sie jetzt mit ihm darüber sprach, hatte sie das Gefühl, zumindest damit begonnen zu haben. Dann kamen sie auf Bücher – bei Belletristik hatten sie einen ähnlichen Geschmack –, aufs Essen – er kochte, doch die Fertiggerichte von Tesco waren ihm, wie er sagte, auch nicht unbekannt – und auf Meriels Wohltätigkeitsvereine. Über die Arbeit sprachen sie nicht. Das Essen war genauso gut, wie er versprochen hatte, altmodisch und typisch Sechzigerjahre italienisch, hervorragend gekocht, wunderbar frisch. Nostalgisch betrachteten sie einige Augenblicke lang die Dessertauswahl – Tiramisu, Zuppa inglese, Tartuffo, Panna Cotta, Zabaglione –, entschieden sich dann aber doch für Cappuccino.
Das Restaurant leerte sich. Sie blieben sitzen, redeten und redeten. Regen schlug plötzlich gegen die Fensterscheiben.
Simon Serrailler fing ihren Blick auf und hielt ihn fest. »Vielen Dank für diesen Abend«, sagte er und lächelte wieder.
Freya hörte Sharon Medcalfs Stimme in ihrem Kopf. Gott, er hat mehr Herzen gebrochen, als ich warme Mahlzeiten gegessen habe. Und der muntere Nathan, das Gesicht voller Sorge um sie. Sie bellen den falschen Baum an, Sarge.
Sie schaute über den Tisch. O nein, den absolut richtigen Baum.
Simon rührte in seinem Kaffee. »Es gefällt Ihnen in Lafferton, oder?«
»Sehr. Ich hätte schon vor langer Zeit hierher ziehen sollen. Ich habe Glück gehabt, so rasch Freunde gefunden zu haben, Glück mit den Kollegen bei der Arbeit. Einfach Glück.«
»Tut mir Leid, Ihnen das mit der Drogenrazzia verdorben zu haben.«
Sie winkte ab. Aber dann durchbrach sie für einen Moment ihre Trance benebelten Entzückens, und sie musste an die anderen denken und was sie ihnen schuldig war.
»Nur eines, Sir – es hat allerdings mit der Arbeit zu tun, und wenn Sie lieber nicht …«
»Nein, ist schon gut. Und hier bin ich Simon.«
Sie merkte, wie sie errötete. Konzentrier dich, sagte sie sich, konzentrier dich. »Ich bin unglücklich darüber, dass die Vermisstenfälle zurückgestuft worden sind.«
Serrailler seufzte. »Ich weiß. Ich verstehe, wie viel Arbeit Sie da reingesteckt haben, aber der Superintendent hat sich die Akten genau durchgesehen und gesagt, es sei genug. Ich hatte keine wirksame Begründung, ihn davon abzubringen. Die Bitte um Mithilfe der Bevölkerung hat sehr wenig ergeben, und Beweise für ein Gewaltverbrechen liegen uns nicht vor.
Weitere Kostenlose Bücher