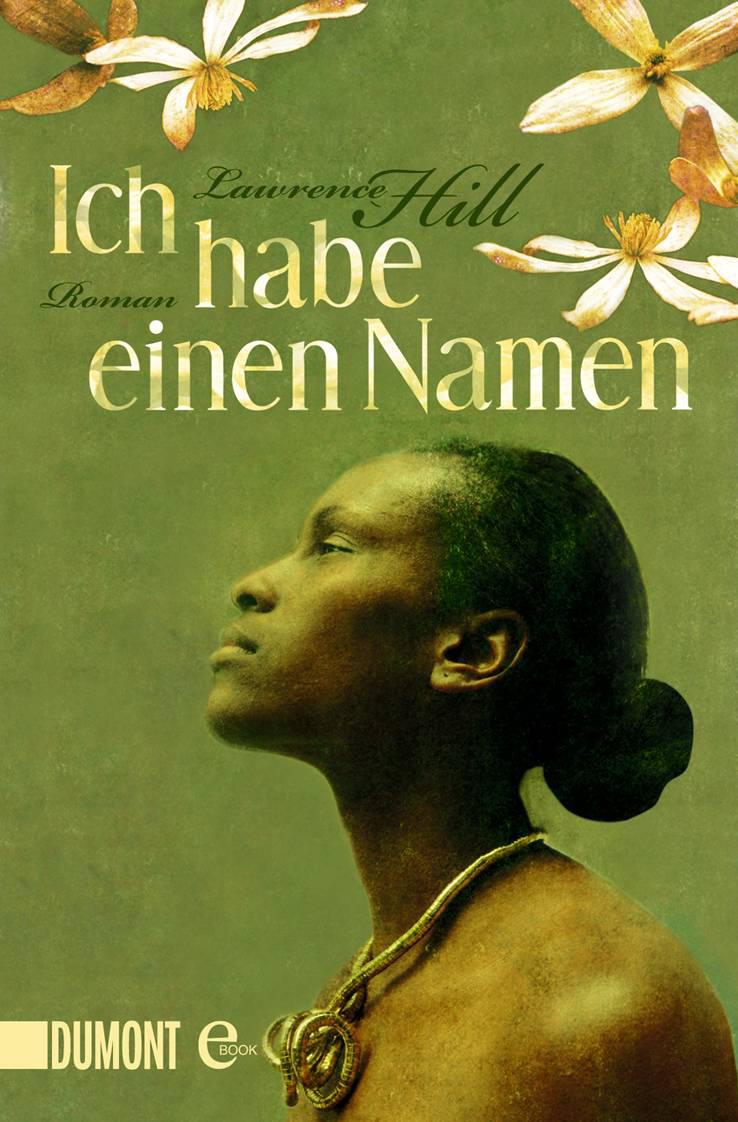![Ich habe einen Namen: Roman]()
Ich habe einen Namen: Roman
Spediteur,
einen Kaufmann oder Sklavenhändler ja. Über London. Aber für Sie? Nein.
Niemals. Welcher Kapitän aus Liverpool würde seine Zeit damit vergeuden, Sie
nach Afrika zu bringen? Er würde Sie ganz einfach wieder in die Sklaverei
verkaufen, und am Ende würden Sie in Barbados oder Virginia landen. Und sollten
Sie es trotz allem tatsächlich bis nach Afrika schaffen, würden die
Sklavenhändler Sie spätestens da wieder einpacken und zurück über den Ozean
bringen.«
Ich sah auf meine
Hände.
»Verlieren Sie nicht
gleich den Mut«, sagte er. »New York ist die beste Stadt für Sie. Es hat viele
Verstecke und reichlich Arbeit zu bieten. Ich habe hier mein Glück gemacht.«
»Aber Sie sind als
freier Mann gekommen.«
»Und Sie sind bereits
in Ihrem Kopf frei. Das ist das Wichtigste. Es gibt in den dreizehn Kolonien
keinen besseren Ort als New York. Auf der ganzen Welt nicht. Vergessen Sie
London. Diese Stadt bietet Ihnen das, was Sie wollen.«
Ich hatte noch tausend
weitere Fragen – wo ich mich verstecken konnte, wie ich Arbeit finden und was
ich tun sollte, um mich zu ernähren … – aber Sam Fraunces hatte keine Zeit
mehr.
»Ich erwarte heute zum
Essen ein volles Haus«, sagte er.
An diesem
Abend nahm mich Solomon Lindo mit in die Trinity Church, wo ein Cellist ein
Solokonzert von Johann Sebastian Bach spielte. Die Trinity Church war die mit
dem höchsten Kirchturm der Stadt.
»Fast fünfundfünfzig
Meter«, sagte Lindo.
Als wir die Stufen
hinaufgingen, kamen wir an schwarzen Männern, Frauen und Kindern vorbei, die
uns ihre Hände entgegenstreckten. Mir war unbehaglich zumute, weil ich ihnen
nichts geben konnte, und hoffte, dass mich das Unglück nicht bald schon an ihre
Seite drängte. Lindo fischte eine Sixpence-Münze aus der Tasche, ließ sie in
die Hand einer Frau fallen und nahm meinen Arm. Seine symbolische Geste machte
mich wütend. Wenn er glaubte, dass ich deswegen am nächsten Tag pflichtschuldig
seine Briefe schriebe, irrte er sich. Im Inneren der Kirche sah ich eine
handgeschriebene Notiz an der Wand hängen: Freiwillige
gesucht, um Neger zu unterrichten .
Wir setzten uns in die
erste Reihe, und ich war dem Cellisten während des Konzerts so nahe, dass ich
fast seinen Bogen hätte berühren können. Es war ein junger schwarzer Mann mit
einem ordentlich geschnittenen braunen Bart und eichelbraunen Augen, die
während seines Spiels mein Gesicht musterten. Er kannte die Musik auswendig,
und statt seinen Blick auf die Seiten mit den Noten zu richten, hielt ihn
dieser Mann, dessen Name laut Programm Adonis Thomas war, auf mich gerichtet.
Er beugte sich über sein Instrument, lehnte sich leicht zurück und wieder vor und
bewegte den Kopf im Takt seines Spiels. Ich hatte das Gefühl, dass er mit mir
sprach.
Ich habe mein ganzes
Leben Schwierigkeiten gehabt, dem hektischen Klang vieler gemeinsam gespielter
Instrumente zu lauschen. In Charles Town hatte ich gelegentlich Flöten, Oboen,
Hörner und Geigen zusammen aufspielen hören und dabei immer den Eindruck
gehabt, es seien gegeneinander ankämpfende Stimmen. Mit dem Spiel dieses
Cellisten konnte ich mich jedoch anfreunden, konnte mich in seine Musik fallen
lassen und ihrem melodischen Vortrieb folgen. Es rührte mich, wie sie tief
hinunterreichte, den Stimmen der Dorfältesten gleich, und dann wieder hoch
hinausführte und aus den Dorfältesten Kinder machte. Adonis Thomas’ Cello
flüsterte meiner Seele zu: Verliere nicht die Hoffnung.
Auch du kannst etwas Schönes schaffen, aber erst musst du deine Freiheit
erlangen .
Lindo hatte
gesagt, ich sollte ihn am nächsten Morgen um acht im Frühstücksraum des Hotels
treffen, aber ich kam schon ein paar Minuten früher, um Sam Fraunces zu sehen.
»Wie war das Konzert?«,
fragte er.
»Es war Musik, die mir
die Stimmung gehoben hat«, sagte ich.
»Hoffen wir, dass es
ihm auch so gegangen ist«, sagte Sam.
»Wem?«
»Adonis Thomas, dem
Cellisten.«
»Was ist mit ihm?«
»Hat Ihnen Lindo nicht
gesagt, dass er der Sklave eines reichen Mannes aus der Stadt ist?«
Mir sank das Kinn
herunter. »Er hat so schön gespielt«, sagte ich.
»Mit echter Sehnsucht,
würde ich annehmen«, sagte Sam.
Lindo kam die Treppe
herunter, und wir gingen ins Frühstückszimmer. Ich hatte noch nie mit einem
weißen Mann an einem öffentlichen Ort gegessen und war überrascht, dass sie
mich mit hineinließen. Es war ein Neger, der unsere Bestellung aufnahm, und er
schenkte mir ein kleines Lächeln. Lindo
Weitere Kostenlose Bücher