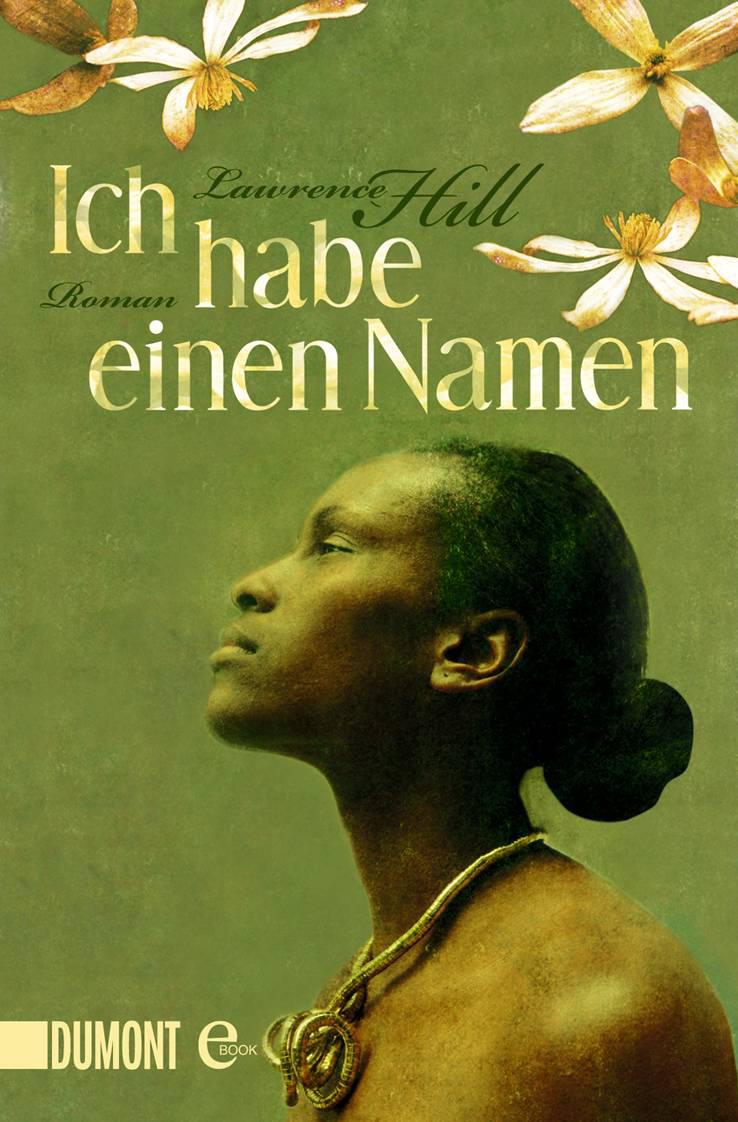![Ich habe einen Namen: Roman]()
Ich habe einen Namen: Roman
Anliegen
erledigen und möglichst schnell wieder von dieser Insel herunter.
»Seht euch das an.«
Armstrong zeigte uns eine Silbermünze. Es war ein spanischer Dollar, auch
bekannt als Acht-Reales-Münze.
Ich erinnerte mich gut
daran, schließlich hatte ich in den Jahren in Charles Town, als ich für Solomon
Lindo gearbeitet hatte, viel damit zu tun gehabt. Aber diese Münze sah etwas
anders aus. Zwar war auf der Rückseite der Kopf von König Carlos III . von Spanien zu sehen, doch in seinen
Hals war ein winziges Bild von König George III . eingeprägt.
Ich sah Armstrong an
und beschloss, ein wenig mit ihm zu reden, würde helfen, mir mein
Selbstvertrauen zurückzuerobern. Ich hörte meine Stimme und sah meinen Gedanken
zu. Ich musste es ihm schwierig machen, mich als mögliche Sklavin zu sehen.
»Ich kenne die
Acht-Reales-Münze«, sagte ich endlich, »aber was macht König George auf dem
Hals von Carlos III .?«
»Einer meiner Männer
hat die Münze aus London mitgebracht«, sagte Armstrong. »Uns gehen die
Silbermünzen aus, also benutzen wir jetzt auch spanische.«
»Aber wir machen sie
englisch«, fügte Falconbridge hinzu.
Armstrong sagte, er
habe einen dummen Vers darüber gehört, und als Falconbridge ihn hören wollte,
sang er: »Die Bank, damit sie’s als ihr Geld ausgeben
kann, prägt den Kopf eines Narren auf einen Esel von Mann.«
Falconbridge lachte,
sagte dann aber: »Denkst du wirklich, dass er so ein Narr ist? Hätte er die amerikanischen
Kolonien etwa einfach ihre Unabhängigkeit erklären lassen und ohne Krieg
abziehen sollen?«
»Der Kampf hat zu lang
gedauert«, sagte Armstrong. »Und ja, er ist ein Narr. Hast du nicht gehört, was
er seinem Sohn angetan hat?«
»Ich weiß, ich weiß«,
sagte Falconbridge und schüttelte den Kopf. »Er soll bei einem seiner Anfälle
versucht haben, den Kopf des Prinzen gegen die Wand zu schlagen. Es heißt, er
hatte Schaum vorm Mund wie ein Rennpferd.«
»Damit schließe ich die
Beweisführung«, sagte Armstrong. »Der Kopf eines Narren auf dem Hals eines
Esels.«
Während die Männer
rauchten und darüber debattierten, ob der König ernsthaft verrückt sei,
entschuldigte ich mich und ging hinüber, um noch einmal die Porträts des Königs
und der Königin zu betrachten. Anschließend strich ich über die Kerzenständer,
setzte mich in einen bequemen Sessel und las in einer englischen Zeitung einen
Artikel über den Komponisten Mozart. Endlich trat ich zu den Fenstern mit den
geschlossenen Fensterläden nach hinten hinaus. Die Männer tranken noch immer,
rauchten und lachten. Ich berührte einen der Fensterläden, der nicht
verschlossen war, und öffnete ihn vorsichtig. Ich sah hinauf zum blauen Himmel,
hörte dann aber menschliches Stöhnen, ließ den Blick sinken und sah auf dem Gelände
hinter der Festung etwa vierzig nackte Männer in einem Pferch. Sie saßen auf
der Erde, hockten auf ihren Fersen oder standen mit hängenden Schultern da. Sie
bluteten und husteten. Einer war an den anderen gekettet, mit Fußeisen. Einen
Moment lang vergaß ich, wie lange es her war, dass ich in Bayo gelebt hatte,
und mühte mich zu sehen, ob ich eines der Gesichter erkennen konnte. Ich
schüttelte den Kopf über meine eigene Dummheit, vermochte den Blick aber nicht
von den Gefangenen zu wenden.
Ein Temne, der richtig
angezogen war und einen schweren Schlagstock an der Hüfte hängen hatte, brachte
einen Kessel mit wässrigem Schleim und kippte ihn in einen Trog. Einige der
Gefangenen humpelten hin und mussten sich in den Matsch knien, um mit dem Mund
an den Trog zu kommen. Zwei Männer lagen bewegungslos im Schlamm, die anderen
gingen um sie herum. Von den Männern durch eine sicher über sieben Fuß hohe
steinerne Mauer abgetrennt, sah ich eine Gruppe von etwa zehn Frauen ohne
Fußeisen. Auch sie waren Gefangene. Auch eine Frau lag reglos da. Ich hasste
mich dafür, dass ich nichts tat, um diesen Menschen aus ihrem erbärmlichen
Gefängnis zu helfen. Ich versuchte mir zu sagen, dass ich nicht die Macht dazu
hatte, tatsächlich aber genügte ihr bloßer Anblick, mich mit Schuld und dem
Gefühl von Mittäterschaft zu erfüllen. Die einzige moralische Möglichkeit hätte
darin bestanden, mein Leben zu opfern, um den Menschendiebstahl zu stoppen.
Aber wie genau sollte ich es opfern, und was würde das ändern?
Eine Hand berührte
meine Schulter. Ich drehte mich zu Falconbridge um.
»Quälen Sie sich
nicht«, sagte er. »Wir wissen beide, was hier
Weitere Kostenlose Bücher