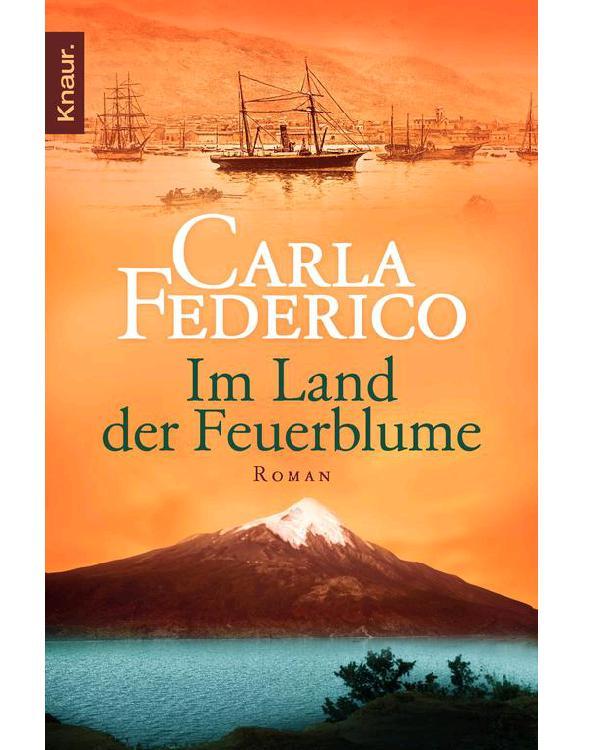![Im Land der Feuerblume: Roman]()
Im Land der Feuerblume: Roman
nie, nie, nie!«
Cornelius zuckte zurück. Zacharias’ Stimme klang nicht einfach nur weinerlich, sondern wie erloschen; nicht üblicher Trotz lag darin, sondern tiefe Verzweiflung.
»Ach, Onkel«, seufzte er. »Wir haben Schlimmes erlebt, aber wir haben es überstanden. Wir sind noch am Leben, das ist ein Geschenk! Und ich bin sicher …«
»Du hast es doch gehört …«, unterbrach Zacharias ihn schroff. Er zog seine Knie ganz eng an sich und vergrub den Kopf zwischen den Armen. Dumpf klang seine Stimme, als er fortfuhr: »Es gibt für uns kein Land hier. Und wenn es welches gäbe – was sollte ich damit? Ich bin kein Bauer, ich bin Pfarrer! Aber als solcher werde ich hier nicht gebraucht. Die Menschen klagen um verlorenes Saatgut, nicht um ihr Seelenheil.«
»Dieser Konrad Weber hat uns auf seine Hazienda eingeladen.« Cornelius versuchte, die Zweifel in seiner Stimme zu verbergen. Hatte das Grinsen des Landsmannes auch jovial gewirkt – das spöttische Lachen und die derben Bewegungen hatten ihn abgestoßen.
»Das ist mir ganz gleich«, murrte Zacharias und scharrte mit den Füßen über den Boden. »Ich gehe hier nicht weg.«
»Aber …«
»Ich rühre mich keinen Schritt weiter. Ich bleibe hier. Hier sind Menschen, und sie leben in Häusern. Irgendwo gibt es gewiss auch eine Kirche.«
»Aber nur eine katholische! Die einzigen Protestanten in diesem Land sind wir Einwanderer!«
Zacharias hob den Kopf und blickte ihn an. Die Wut war aus seinem Gesicht verschwunden, sogar die Verzweiflung. Zurück blieb nur ein Ausdruck tiefster Erschöpfung. »Ich folge einem Fremden, von dem wir nichts wissen, ganz sicher nicht in den Urwald!«
Die Gelegenheit, den Onkel zu umarmen, war längst vorüber. Dennoch legte Cornelius vorsichtig die Hand auf seine Schultern.
»Wovon willst du denn hier leben?«, fragte er.
»Auch wenn es nur Katholiken sind – einen Mann Gottes wie mich wird man nicht verhungern lassen. Und wenn dieser Konrad Weber unsereins Arbeit anbietet, dann werden das auch andere tun, und zwar hier und nicht irgendwo in einer gottverlassenen Einöde.«
Erstaunlich nüchtern klang, was er sagte. Erst als er Cornelius plötzlich die Hand reichte, sich von ihm hochziehen ließ, wirkte er wieder hilflos und weinerlich wie ein Kind.
»Du bleibst doch bei mir? Du lässt mich doch nicht im Stich?«
»Onkel Zacharias …«
Cornelius konnte sich nicht erinnern, sich auf der Reise jemals so mutlos gefühlt zu haben. Trotz aller Gefahren, trotz aller Ungewissheit war es immer irgendwie weitergegangen. Doch jetzt war ihm, als würde er ohne Hoffnung in einem Niemandsland festsitzen.
»Corral … diese Stadt«, fuhr Pastor Zacharias fort, »sie liegt doch in der Nähe, heißt es. Dorthin können wir meinetwegen gehen. Aber nicht weiter.«
Cornelius wusste nichts zu sagen. Was würde aus Elisa werden? Wie sollte er sie einfach mit Konrad Weber aufbrechen lassen und selbst hier zurückbleiben?
»Du lässt mich doch nicht im Stich!«, drängte Pastor Zacharias wieder, und diesmal klang es nicht weinerlich, sondern schmeichelnd.
Obwohl sie ungesagt blieben, konnte Cornelius die Worte förmlich hören, die der Onkel im Stillen dachte.
Weil auch ich dich niemals im Stich gelassen hatte. Weil ich meine Schwester und den Bastard, den sie im Leibe trug, einst nicht verstoßen habe wie der Rest der Familie, sondern ihnen eine Heimat bot.
»Bleib bei mir«, seufzte der Onkel, »ich bitte dich: Bleib bei mir.«
Fest drückte er Cornelius’ Hand.
»Ohne dich gehe ich nirgendwo hin«, sagte dieser leise.
Notdürftig flickte Elisa ihr Gewand. Sie hatte weder Garn noch Nadeln, aber sie zog aus den zerrissenen Stellen Fäden, bohrte diese mit den Fingernägeln in das Stoffgewebe und verknotete sie. Sie hatte keine Hoffnung, dass das lange halten würde, aber zumindest wurden so die größten Risse zusammengehalten. Derart konzentriert merkte sie nicht, wie ein Schatten auf sie fiel.
Erst als Cornelius ihren Namen aussprach, fuhr sie hoch.
»Da bist du ja! Du bist vorhin plötzlich verschwunden, als diese Frau gekommen ist … eine Spanierin. Hast du sie noch gesehen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Sie hat uns Essen gebracht! Warte«, sie strich ihr Kleid glatt und erhob sich, »vielleicht sind noch Maisfladen da. Sie schmecken viel besser als das Brot der Soldaten.«
Sie hatte das Gefühl gehabt, nie etwas Köstlicheres gegessen zu haben als jenen feinen, gelblichen Teig aus Maismehl, außen kross und
Weitere Kostenlose Bücher