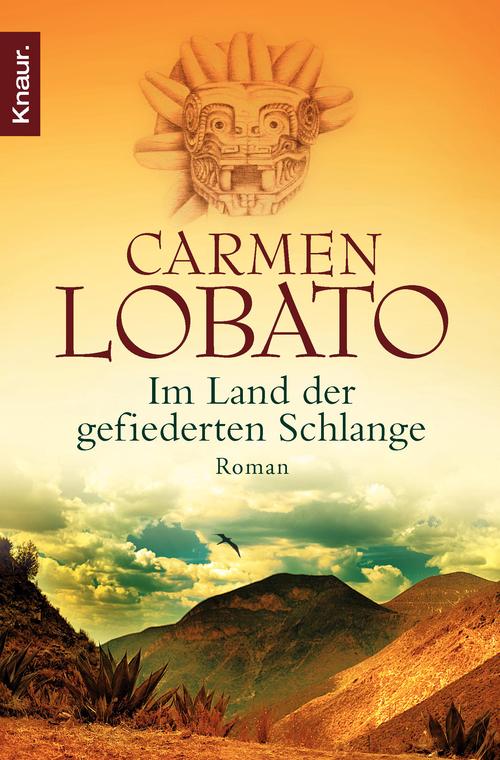![Im Land der gefiederten Schlange]()
Im Land der gefiederten Schlange
Weihnachten gestorben. Und die Union verkauft unseren Leuten jetzt Waffen, sogar schwere Geschütze. Xavier sagt, wir sollen beten und verstohlen feiern, denn es besteht ein wenig Hoffnung. Aber wie lange es dauert und wer dann noch übrig ist – wer weiß das schon?«
Die Graue nickte. Sie trank ihren Tee nicht, wärmte sich nur die Hände daran. »Ich glaube, ich werde nicht übrig sein, Doña Carmen. Don Benito hat zu mir gesagt: Wenn es an der Zeit ist, soll ich es ihn wissen lassen. Es ist jetzt an der Zeit. Aber wissen lassen kann ich es Don Benito wohl nicht.«
»Nein«, sagte Carmen und stand auf, weil Mitleid mit der Frau sie überwältigte. Sie trat hinter sie und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Unter der Berührung zuckte die Graue zusammen. »Ich denke, wir müssen eine Zeitlang mit unseren Sorgen allein fertig werden, wir können sie nicht auch noch Benito aufbürden. Ich habe ihm nicht einmal geschrieben, dass mein Mann gestorben ist. Für den Krieg muss alles warten. Auch der Tod.«
Noch einmal nickte die Graue. »Es ist nur – wenn ich tatsächlich nicht durchhalte, bis der Krieg zu Ende ist, können Sie Don Benito dann sagen, er soll selbst tun, was ich nicht mehr kann?«
Die Graue weinte nie. Die Alten im Dorf sagten, bei dem Schrecken, bei dem ihr Haar grau geworden und ihr Lächeln erstarrt sei, seien auch ihre Tränen versiegt. Ihre Stimme aber war schlimmer als Weinen. Sie klang, als würde sie zerbröckeln. Mit steifer Hand strich Carmen ihr über das Haar, das sich weich wie das Haar eines Mädchens anfühlte. »Sie müssen darum keine Angst haben. Wenn Ihnen keine Zeit bleibt, mit Katharina zu sprechen, wird Benito es tun.«
Bei der Nennung des Namens war die Graue erneut zusammengezuckt. Carmen fürchtete sich immer ein wenig, ihn auszusprechen, aber etwas in ihr war sicher, dass es die alte Frau glücklich machte. »Don Benito lässt sie nicht im Stich, nicht wahr?«
»Bestimmt nicht.« Um ein Haar hätte Carmen gelacht.
»Wird sie es aushalten? Wird sie nicht daran zerbrechen?«
»Ich kenne sie nicht«, erwiderte Carmen, die auch die Geschichte der Grauen nicht bis in die letzten grausamen Einzelheiten kannte. »Aber ich glaube, sie wird mit der Wahrheit besser leben als im Ungewissen. Und sie wird nicht allein sein.«
Die Graue schloss die Augen. Ihre Mundwinkel zuckten.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte Carmen. »Danke für den Tee.«
»Kommen Sie wieder, wenn Sie etwas hören?«
»Natürlich«, antwortete Carmen. »Vielleicht ist ja auch der Krieg bald vorbei.«
»Ja, vielleicht. Haben Sie meine Agave gesehen?«
»Sie blüht«, sagte Carmen, ging und schloss die Tür hinter sich. Als sie die Felsnase umrundet hatte, hielt sie inne, sah hinunter auf ihr Haus mit den grünen Türen und sandte ein Gebet in den Wind: Gott, wer immer du bist, lass es nach dem Krieg nicht zu spät sein. Schenk all denen, die warten, nach dem Krieg noch fünfzehn Jahre Zeit.
51
Die Habanera von der Taube, die einem Mädchen einen letzten Liebesgruß brachte, war der Ohrwurm, zu dem das vom Krieg zerrissene Mexiko tanzte. Über Nacht war
La Paloma
zum Lieblingslied einer Nation geworden. Der Mann der Vollbusigen hatte recht behalten. Die Peralta war eine verkappte Liberale, die am Morgen nach der Premiere nach Veracruz und dann per Schiff nach Kuba flüchtete. Ihr Lied aber blieb zurück. Ob kaisertreu oder republikanisch, ob Mexikaner oder Extranjero, ein jeder sang es, pfiff es, wiegte sich in seinem Takt. Katharina schien der einzige Mensch zu sein, der es nicht ertrug. Es war ihr Alptraumlied.
Seit jenem Morgen hatten die Träume vom Malecon nicht mehr aufgehört. Sie begann die Nächte zu fürchten. Stundenlang lag sie wach und wagte aus Angst vor den Bildern nicht, die Augen zu schließen, doch sobald sie in Schlaf fiel, liefen die Bilder Sturm. In Fetzen gerissene Haut, Ströme von Blut, die sich zu einem Meer vereinten. Die Schnur der Peitsche, die Gesichter der Gaffer, und über allem der Blick, der sie traf und den sie nie mehr abschütteln konnte. Kein Möwen- und auch kein Taubenschrei. Stattdessen der dunkle Sopran der Peralta, die
La Paloma
sang.
An jenem Tag hatte Valentin sich krankgemeldet und war mit ihr zurück nach Chapultepec gefahren. »Du wirst mir das nicht verzeihen, nicht wahr?«, hatte er gefragt.
»Doch«, hörte Katharina sich sagen. »Ich dir und du mir. Ich liebe dich.« Sie hatten die Tür des Gartenhauses hinter sich verschlossen und waren
Weitere Kostenlose Bücher