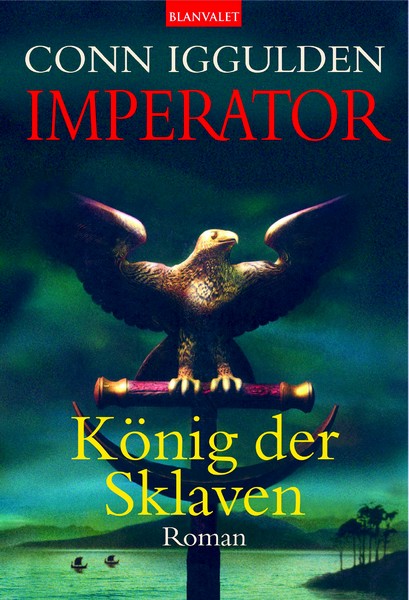![Imperator 02 - König der Sklaven]()
Imperator 02 - König der Sklaven
sie sie herstellen konnte, und obwohl sie für den größten Teil des Gewinns neue und edlere Metalle erwarb, blieb doch jeden Monat genug übrig, um etwas beiseite zu legen. Vielleicht hatte sie durch ihr Sklavendasein gelernt, den Wert des Geldes zu schätzen, denn sie trauerte jeder Bronzemünze nach, die sie für Essen oder ein Dach über dem Kopf ausgeben musste. Eine hohe Miete zu zahlen kam ihr wie eine Riesenidiotie vor, wenn einem letztendlich nichts davon gehören würde, nachdem man jahrelang sein hart verdientes Geld dafür hergegeben hatte. Es war besser, so wenig wie möglich auszugeben und sich eines Tages ein eigenes Haus zu kaufen, dessen Tür sie vor allem Ungemach der Welt verschließen konnte.
»Nimmst du das Zimmer?«, fragte die Besitzerin.
Alexandria zögerte. Sie war versucht, die Miete weiter herunterzuhandeln, aber die Frau sah erschöpft aus, nachdem sie den ganzen Tag über auf dem Markt gearbeitet hatte, und der Preis war durchaus angemessen. Es wäre nicht richtig gewesen, die offensichtliche Armut der Familie auszunutzen. Alexandria sah die Hände der Frau, die von der Farbe in den Färbebottichen fleckig und wund waren und einen blassblauen Schmierer über dem Auge zurückließen, als sie sich mit einer unbewussten Geste die Haare zurückstrich.
»Ich sehe mir morgen noch zwei andere an. Dann sage ich dir Bescheid«, erwiderte Alexandria. »Soll ich morgen Abend vorbeikommen?«
Die Frau schaute sie resigniert an und zuckte die Achseln. »Frag nach Atia. Ich bin bestimmt hier irgendwo. Aber für den Preis, den du zahlen willst, findest du nichts Besseres. Das ist hier ein sauberes Haus, und die Katze kümmert sich um die Mäuse, die womöglich von draußen reinkommen. Wie du willst.« Sie wandte sich ab und begann die abendlichen Arbeiten damit, dass sie die Lebensmittel zubereitete, die sie als Teil ihres Lohns vom Markt mitgebracht hatte. Das meiste davon war wohl schon fast verdorben, das wusste Alexandria, trotzdem schien Atia ungebrochen von der Mühsal ihres Lebens.
Es war seltsam, eine freie Frau am Rande der Armut zu sehen. Auf dem Gut, auf dem Alexandria gearbeitet hatte, waren sogar die Sklaven besser ernährt und gekleidet gewesen als die Familie dieser Frau. Aus dieser Warte hatte sie das Leben noch nie betrachtet, und es überkam sie ein seltsames Gefühl der Scham, als sie hier in ihren guten Kleidern stand, mit einer ihrer eigenen Silberbroschen als Schließe ihres Umhangs.
»Ich sehe mir die anderen an und komme dann wieder«, sagte Alexandria entschlossen.
Atia machte sich ohne weiteren Kommentar daran, das Gemüse klein zu schneiden und es in einen eisernen Tiegel zu werfen, der auf einem an die Wand gebauten Lehmofen stand. Selbst die Klinge des Messers, das sie benutzte, war abgenutzt und so schmal wie ein Finger, wurde aber in Ermangelung eines besseren immer noch verwendet.
Draußen auf der Straße wurde plötzlich schrilles Geschrei laut. Kurz darauf kam eine schmuddelige Gestalt durch die Tür gerannt und prallte mit Alexandria zusammen.
»Langsam, Bursche! Du hättest mich ja fast umgerannt!«, sagte Alexandria lächelnd.
Spöttisch sah er sie an. Sein Gesicht war so schmutzig wie der Rest, aber Alexandria konnte trotzdem sehen, dass seine Nase dunkel und geschwollen war. An der Nasenspitze klebte ein Rest Blut, das er sich über die Wange schmierte, als er sich schniefend die Nase abwischte.
Die Frau ließ das Messer fallen und schloss ihn in die Arme. »Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt?«, fragte sie ihn und legte besorgt die Finger auf die blutige Nase.
Der Junge grinste und versuchte sich aus ihrer Umarmung zu befreien.
»Nur eine kleine Rauferei, Mama. Die Jungen, die beim Metzger arbeiten, haben mich bis nach Hause gejagt. Ich habe einem von ihnen ein Bein gestellt, als er auf mich losgehen wollte, da ist er auf meiner Nase gelandet.« Der Junge strahlte seine Mutter an, griff unter seine Tunika und zog zwei unverpackte, bluttriefende Koteletts hervor. Seine Mutter stöhnte und nahm sie ihm mit einer schnellen Handbewegung weg.
»Nein, Mama. Die gehören mir! Ich habe sie nicht gestohlen. Sie lagen einfach auf der Straße.«
Das Gesicht seiner Mutter wurde bleich vor Wut, trotzdem hielt er sie mit aller Kraft fest, als sie auf die Tür zuging, und sprang so hoch wie möglich, um ihr seine Beute wieder abzujagen.
»Ich habe dir gesagt, du sollst nicht stehlen und nicht lügen. Nimm deine Hände weg. Wir müssen das hier wieder
Weitere Kostenlose Bücher