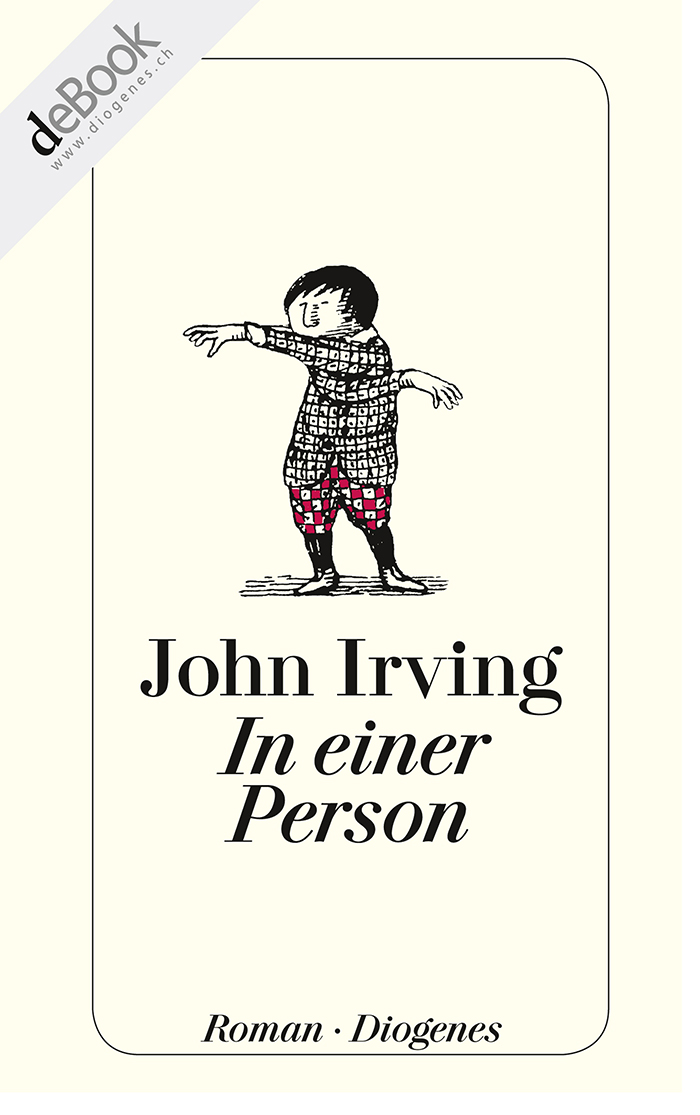![In einer Person]()
In einer Person
Herzmedizin, wenn Onkel Bob
recht hatte.
Wir umarmten uns zum Abschied; es war unsere letzte Begegnung. Herm
Hoyt starb später in der Einrichtung für betreutes Wohnen an einem
Schlaganfall; Onkel Bob brachte es mir bei. »Der Trainer ist von uns gegangen,
Billy – du bist allein mit den Durchschlüpfern.« (Lange hatte er nicht mehr
durchgehalten; wenn mich nicht alles täuscht, wurde Herm Hoyt fünfundneunzig.)
Als ich die Einrichtung für betreutes Wohnen verließ, stand die alte
Pflegerin wie zuvor rauchend davor, und Dr. Harlows verhüllter Leichnam lag
unverändert auf der Transportliege. »Immer noch am Warten«, sagte sie, als sie
mich sah. Allmählich blieb der Schnee auf der Leiche liegen. »Ich denk mir, ich
roll ihn nicht wieder rein«, teilte mir die Pflegerin
mit. »Er spürt nicht, wie der Schnee auf ihn fällt.«
»Ich werd Ihnen mal was über ihn sagen«, erklärte ich. »Der ist
jetzt ganz genau so, wie er immer war – todsicher.«
Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette und blies den Rauch
über Dr. Harlows Leichnam. »Mit Ihnen werd ich mich
nicht über Ausdrücke streiten«, sagte sie. » Sie sind
der Schriftsteller.«
An einem verschneiten Dezemberabend nach Thanksgiving stand ich
in der Seventh Avenue im West Village und schaute Richtung uptown Manhattan.
Ich stand vor dieser Endstation von einem Krankenhaus, St. Vincent’s, und
versuchte mich zu zwingen hineinzugehen. Dort oben, wo die [616] Seventh Avenue
auf den Central Park trifft, lag die rein männliche Sakko-und-Krawatten-Bastion
des New York Athletic Club, aber zu weit nördlich, als dass ich ihn sehen
konnte.
Meine Füße versagten mir den Dienst. Bis ganz zur West Twelfth oder
auch nur West Eleventh Street hätte ich nicht auf allen vieren kriechen können;
wäre ein rasendes Taxi an der nahe gelegenen Kreuzung von Greenwich Avenue und
Seventh mit einem anderen Taxi kollidiert, ich hätte mich nicht vor den
umherfliegenden Autowrackteilen in Sicherheit bringen können.
Der fallende Schnee weckte mein Heimweh nach Vermont, aber die
Vorstellung, quasi »nach Hause« zu ziehen, lähmte mich völlig, und Elaine hatte
vorgeschlagen, wir sollten versuchen zusammenzuziehen, aber nicht in New York.
Die Vorstellung, wieder irgendwo mit Elaine zusammenzuwohnen, lähmte mich noch
viel mehr; ich wollte es gern versuchen, fürchtete mich aber auch davor.
(Leider hegte ich den Verdacht, sie wolle mit mir zusammenleben, weil sie
irrtümlich annahm, das würde mich vor dem Sex mit Männern »retten« – und somit
vor einer Ansteckung mit Aids »bewahren« –, aber ich wusste, nicht eine Person
konnte mich vor dem Wunsch bewahren, mit Männern und Frauen Sex zu haben.)
Als wären diese Gedanken nicht schon lähmend genug gewesen, blieb
ich auch noch deshalb wie angewurzelt auf dem Bürgersteig der Seventh Avenue
stehen, weil ich mich entsetzlich schämte. Wieder einmal war ich kurz davor,
diese trauerumflorten Flure des St. Vincent’s abzuklappern, aber diesmal nicht, um einem sterbenden Freund oder [617] Exlover Trost zu
spenden, sondern, so absurd das auch klingen mochte, auf der Suche nach
Kittredge.
Es war kurz vor Weihnachten 1984, und Elaine und ich suchten immer
noch in diesem Krankenhaus mit dem Namen eines Heiligen – und dazu in diversen
Hospizen – nach einem grausamen Jungen, der uns schlecht behandelt hatte, als
wir alle noch so jung gewesen waren.
Elaine und ich suchten ihn jetzt schon seit drei Jahren. »Vergesst
ihn«, hatte Larry uns gesagt. »Wenn ihr ihn findet, wird er euch nur
enttäuschen – oder wieder weh tun. Ihr seid beide Mitte vierzig. Ist das nicht
ein bisschen zu alt, um einen Dämon eurer unglücklichen Jugendjahre
auszutreiben?« (Das Wort Jugend konnte Lawrence Upton
einfach nie auf nette Art sagen.)
All das muss mich an diesem verschneiten Dezemberabend in der
Seventh Avenue ausgebremst haben, aber dass Elaine und ich uns – jedenfalls was
Kittredge anging – wie Jugendliche aufführten, trieb mir jedenfalls die Tränen
in die Augen. (Als Jugendlicher hatte ich sehr viel geweint.) Da stand ich also
weinend vor St. Vincent’s, als sich mir eine ältere Frau im Pelzmantel näherte.
Sie war vielleicht Mitte sechzig und wirkte nicht nur reich, sondern auch immer
noch hübsch; hätte sie noch das ärmellose Kleid und den Strohhut getragen wie
bei meiner ersten Begegnung mit ihr, als sie sich geweigert hatte, mir die Hand
zu geben, hätte ich sie wahrscheinlich sofort wiedererkannt. Als
Weitere Kostenlose Bücher