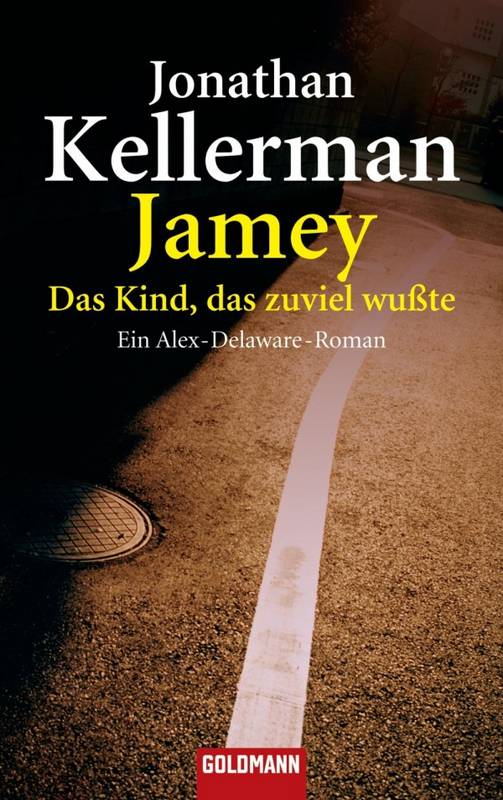![Jamey. Das Kind, das zuviel wußte]()
Jamey. Das Kind, das zuviel wußte
gemeinsam hatten: plötzliche Erregungszustände und Verwirrung bis hin zu gewalttätigen Ausbrüchen, Paranoia, auditive Halluzinationen und anschließend eine stille, depressive Phase. PCP konnte oral verabreicht werden, es wirkte für Stunden, aber auch für Wochen. Aber genauso wie bei DMT war das unvorhersehbar. Darüber hinaus waren die Reaktionen von der Dosierung abhängig: Geringe Dosen konnten Dumpfheit oder Euphorie, mittlere Dosen Schmerzunempfindlichkeit auslösen. Eine durch Überdosierung verursachte Psychose konnte schnell zum Koma und zum Tod führen. Eine konstante Verabreichung von PCP konnte jemanden genauso gut töten wie verrückt machen. Das Mittel war ungeeignet für eine beabsichtigte Vergiftung.
Es gab noch ein weiteres Problem bei PCP, das ich mit Jennifer erörtert hatte: Mainwaring hatte bei der Blutprobe nichts gefunden. Wenn man dem Psychiater überhaupt vertrauen durfte.
Wenn nicht, was war dann? Ein übles Spiel, bei dem der Heiler seine Kenntnisse nutzte, um jemanden verrückt zu machen? Oberflächlich gesehen ergab das einen Sinn. Es löste das Problem der dosierten Verabreichung. Ein »biochemischer Ingenieur« hatte das notwendige Wissen, um die Dosierung von Drogen für eine geistige Beeinflussung genau zu berechnen. Damit kam ich jedoch nicht weiter, denn Mainwaring war erst auf der Bildfläche erschienen, nachdem sich Jameys Zustand zunehmend verschlechtert hatte. Selbst wenn er vorher beteiligt worden wäre, welches Motiv konnte er für die Vergiftung eines Patienten haben?
Widersprüchliche Bilder liefen in mir wie ein Film ab: Punk-Plastiken, schwarze Bücher, Wasserkraftwerke und blutige Fetzen eines lavendelfarbenen Kleids. Ich hörte Milo schimpfen: »Noch eine Verschwörung, mein Junge?«, und stellte fest, dass mich die intellektuellen Grübeleien einer Siebzehnjährigen - obwohl außerordentlich intelligent - in ein mysteriöses Ratespiel verstrickt hatten.
Intellektuelle Übungen für Müßiggänger, dachte ich und starrte auf den Bücherstapel vor mir. Die reinste Zeitverschwendung.
Trotzdem las ich weiter, und es stellte sich heraus, dass ich Unrecht gehabt hatte.
Ich stieß auf zwei viel versprechende Fundstellen. Durch eine schwedische Abhandlung, die oberflächlich auf die Wirkung von Nervengiften bei der chemischen Kriegführung einging, geriet ich in die Abteilung der botanischen Literatur und suchte nach der Monografie eines gewissen McAllister von der Stanford University. Das Buch fehlte. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl hinunter zum Erdgeschoss und ging zur Ausleihe, weil es vielleicht schon zurückgegeben, aber noch nicht wieder ins Regal gestellt worden war. Der Bibliothekar war ein stämmiger Schwarzer, der Typ eines Quarterbacks, der, nachdem er fünf Minuten auf einer Computertastatur herumgeklappert und auf den Bildschirm geglotzt hatte, kopfschüttelnd zurückkehrte. »Tut mir Leid, Sir. Das Buch ist nicht verliehen worden, es wird vermutlich irgendwo in der Bibliothek sein. Manche lassen die Bücher einfach neben dem Fotokopierer liegen.«
Ich bedankte mich und suchte bei den Fotokopiermaschinen, fand das Buch aber nicht. Ich wusste, dass es ebenso leicht war, in dieser Bibliothek ein einzelnes Buch zu finden, wie die berühmte Nadel im Heuhaufen, deshalb suchte ich nach meiner zweiten Informationsquelle und stieg die Treppe zum untersten Stockwerk, vier Etagen unter der Erde, hinunter.
Ich gelangte in einen verstaubten Kellerraum, in dem überall Metallregale standen, die vom Boden bis zur Decke mit alten Folianten voll gestopft waren. Diese Sammlung schien für die moderne Medizin weniger interessant zu sein, sie dämmerten weltabgeschieden vor sich hin wie Literaturgreise.
Alles zusammen wirkte wie ein Leichenschauhaus für Bücher, still und düster, an der Decke ein Gewirr von Rohren, die Wände verschimmelt und rostfleckig. Eines der Rohre war undicht, langsam tropfte daraus Wasser und bildete neben einem Bücherregal auf dem Fußboden eine große Pfütze; einige der Bücher waren deshalb feucht und aufgequollen.
Verschiedene Bände waren in fremden Sprachen geschrieben, in Latein, Deutsch oder Französisch. Fast alle hatten Eselsohren. Ich musste mich anstrengen, um die verblichenen Titel auf den verwitterten Buchrücken zu entziffern. Schließlich fand ich den Band, den ich gesucht hatte, und nahm ihn mit in einen Leseraum.
Er war in steifes weißes Leinen gebunden, das mit der Zeit nachgedunkelt war und die Farbe von Milchkaffee
Weitere Kostenlose Bücher