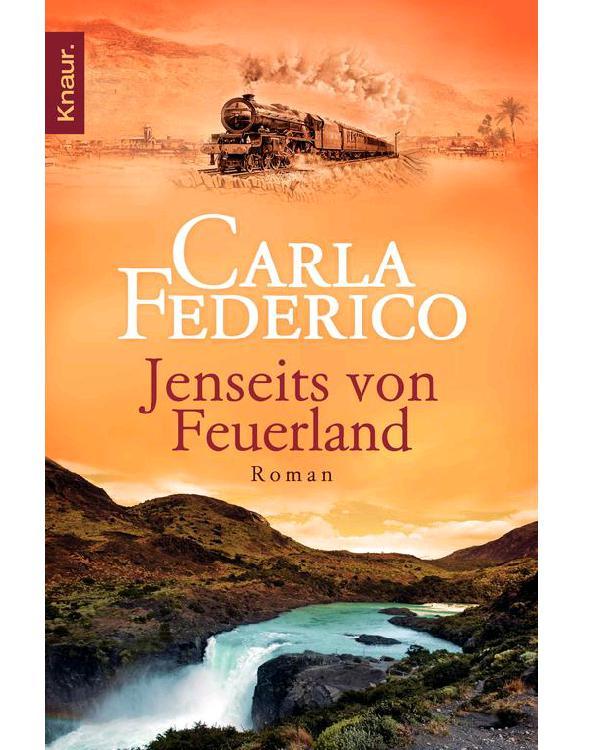![Jenseits von Feuerland: Roman]()
Jenseits von Feuerland: Roman
erfahren hatte, hatte sie Esteban eigentlich schon lange sagen wollen, hatte es nur darum aufgeschoben, weil er ständig betrunken gewesen war. Sie hatte so sehr gehofft, es würde ihn freuen, würde ihn ein wenig mit ihr und der Welt versöhnen. Doch als er sie nun so hasserfüllt anstarrte, war sie sich nicht mehr sicher, ob sie es ihm überhaupt sagen sollte.
»Als du die Herberge angezündet hast«, sagte sie mit krächzender Stimme, »hast du nicht daran gedacht, dass das Kind deines sein könnte?«
Er stierte sie durch die dunklen Haare an. »Na und? Hab dem Rothautbastard doch nur ein sinnloses Leben erspart.«
Er gab es also zu. Er hatte es tatsächlich getan.
Agustina ballte ihre Hände zu Fäusten. Sie fühlte nicht das übliche Mitleid, die Schuld und die Scham über ihr eigenes Versagen, nur Überdruss stieg in ihr hoch. Sie konnte es nicht mehr hören, wie er alles Übel dieser Welt darauf zurückführte, dass er ein Bastard war.
»Das hast du nicht«, sagte sie leise. »Ich habe erfahren, dass die Frauen leben und das Kind auch.« Sie machte eine kurze Pause. »Gott sei Dank«, fügte sie dann hinzu.
»Was geht’s mich an?«, rief er unwirsch.
Er wollte sich abwenden, doch da packte sie ihn an den Schultern. Schon seit langem hatte sie nicht gewagt, ihn zu berühren. »Es ist doch nicht möglich, dass du so gar kein Mitleid hast!«
Kurz wähnte sie etwas in seinen Augen aufflackern – einen Funken Schmerz, wenn auch mit Zorn gepaart. Genau genommen, war all sein Schmerz stets mit Zorn gepaart und vielleicht gerade darum so unerträglich, so unkontrollierbar, ähnlich hitzig, bitter, ätzend wie der Rauch, der über der abgebrannten Casa Emilia hing. Er hob die Hand, und noch ehe sie zurückweichen konnte, schlug er ihr ins Gesicht. Agustina taumelte.
»Lass mich in Ruhe, Mutter!«
Sie schmeckte Blut in ihrem Mund, schluckte es herunter und leckte sich auch über die Lippen, damit es nicht über ihr Kinn perlte. Sie fühlte nichts mehr, keinen Überdruss und keinen Schmerz. Sie wusste nur plötzlich, was sie zu tun hatte.
Am nächsten Morgen machte sie sich auf den Weg zu Ernesta Villans Bordell. Sie hatte große Angst, aber sie ließ sich nicht von dieser Angst bezwingen. Angst war ein stetiger und darum altvertrauter Begleiter ihres Lebens. Immer hatte sie Angst gehabt. Angst vor dem Vater, Angst vor der Gosse, Angst vor dem eigenen Sohn. Nun hatte sie Angst vor Emilia, fast noch mehr als vor Ernesta Villans stechendem Blick, dennoch setzte sie Schritt vor Schritt und kam dem verruchten Ort immer näher. Erst als sie unmittelbar davorstand, jenem mehrstöckigen Gebäude, das Saloon, Bordell und Ernestas private Räume beherbergte, geriet sie ins Zögern.
Wie sollte sie Emilia gegenübertreten? Wie die richtigen Worte finden, um zu erklären, was sie sich ausgedacht hatte?
Kurz schwankte sie in ihrem Entschluss, aber da hatte eine von Ernestas Frauen sie bereits erblickt und erzählte es rasch weiter. Wenig später trat Ana auf der Straße zu ihr und fragte barsch, was sie hier wollte.
»Emilia«, murmelte Agustina. »Ich muss mit Emilia reden.«
Sie hielt den Blick gesenkt, als sie nach oben stiegen. Auch als sie Ernestas Räume betraten, wagte sie den Kopf nicht zu heben. Nur aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass Emilia zu ihr trat – Rita hingegen sah sie nicht. Wie es ihr wohl ging, ihr und dem Kind, diesem winzigen Kind, das sie schon einmal in den Armen gehalten hatte? Halb liebevoll, halb ängstlich hatte sie es gemustert und hatte nicht gewusst, ob sie darauf hoffen sollte, Estebans Züge in ihm zu erkennen oder nicht.
»Was machst du hier?«
Langsam hob Agustina den Kopf. Emilia sah mitgenommen aus, aber wollte es sich wie so oft nicht anmerken lassen. Sie presste ihre Lippen trotzig zusammen und hielt das Kinn stolz vorgereckt.
Woher nahm sie nur diese Stärke?, durchfuhr es Agustina. Stärke, die sie selbst nie auch nur annähernd besessen hatte?
Nun, vielleicht hatte sie doch ein bisschen davon, sonst wäre sie schließlich nicht hier.
»Es … es tut mir so leid.«
»Spar’s dir«, fuhr Emilia sie an, um – als Agustina zusammenzuckte – gemäßigter hinzuzusetzen: »Ich glaube dir sogar, dass es dir leidtut. Aber er ist dein Sohn. Wie oft wird er mein Leben noch zerstören? Bis ich endlich tot bin?«
Agustina war, als würde ein Lederband um ihren Hals gezogen werden, immer fester, immer enger, bis ihr sämtliche Luft wegblieb. Verzweifelt atmete sie
Weitere Kostenlose Bücher