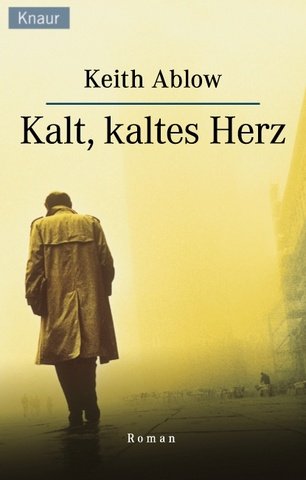![Kalt, kaltes Herz]()
Kalt, kaltes Herz
Moment einflüsterte, daß ich seine Akte aus einem ganz bestimmten Grund in der Hand hielt. Es war kein Zufall, daß er genug von seinem Namen preisgegeben hatte, um die Tür zur Vergangenheit zu öffnen.
Ich blätterte wieder zum Anfang zurück und las das Deckblatt. Dort waren Westmorelands Entlassungsdatum aus der Armee und der Tag seiner Einweisung ins Krankenhaus verzeichnet. Die Adresse seiner Familie war mit Warren Avenue12, Charlestown angegeben, ein heruntergekommenes Arbeiterviertel am nördlichen Rand von Boston. Nächster Verwandter war sein Vater John LaFountaine. Ich schlug die erste der beiden handgeschriebenen Seiten auf, die mit »Psychiatrischer Krankengeschichte« betitelt war:
George LaFountaine,
22,
männlich, wurde aus gesundheitlichen Gründen aus der Armee entlassen. Anlaß hierfür waren eine nach einem militärischen Einsatz aufgetretene Paranoia und akustische Halluzinationen. Auf diese psychotischen Symptome wird auch Mr. LaFountaines bizarres Verhalten in jüngster Zeit zurückgeführt, das eine Verhandlung vor dem Kriegsgericht zur Folge hatte. Das Verfahren wurde in allen Anklagepunkten eingestellt. Der Patient wurde zur psychiatrischen Untersuchung und Behandlung überstellt.
Am
21.
November nahm Mr. LaFountaine, in der Vergangenheit wegen Tapferkeit ausgezeichnet, als Mitglied einer Eliteeinheit am Überfall auf das Gefangenenlager Son Tay in der Nähe von Hanoi teil. Für diese Operation war er zuvor gründlich ausgebildet worden. Man hatte angenommen, daß amerikanische Kriegsgefangene dort festgehalten wurden, doch man fand das Lager verlassen vor. Der Patient verbrachte mehrere Stunden mit der Durchsuchung leerer Gebäude, von denen einige vermint waren. Ein enger Freund, der gemeinsam mit dem Patienten die Häuser durchkämmte, wurde durch einen Sprengsatz getötet.
Ich blickte auf und versuchte, mir den Wirrwarr aus Hoffnung, Angst, Haß und Panik vorzustellen, der in LaFountaine getobt haben mußte, während er das verlassene Lager Raum für Raum durchsuchte. Ich malte mir aus, wie er seinen sterbenden Freund in den Armen hielt, gefallen bei einer Mission, durch die niemand befreit wurde, getötet von einem unsichtbaren Feind.
»Lassen Sie das«, schimpfte Rusty.
»Was?«
»Sie schauen mir beim Essen zu. Ich habe Sie doch gebeten, das nicht zu tun.«
»Ich habe nicht zugeschaut, sondern nur nachgedacht.«
»Schon gut. Wahrscheinlich darüber, was für ein Vielfraß ich bin.« Sie sammelte ihre Gemüsetütchen ein und stand auf. Im Stehen wirkte sie noch magerer. »Ich mache Ihre Spielchen nicht mit.«
Ich konnte es einfach nicht dabei bewenden lassen. Menschliches Leid hat schon immer einen unwiderstehlichen Reiz auf mich ausgeübt. »Die Wahrheit ist doch, Rusty, daß Sie nie genug bekommen Haben, nicht daß Sie zu viel essen.« Sie trat einen Schritt auf mich zu. »Wie kommen Sie dazu, mich mit Ihrem oberflächlichen Psychokram zu belästigen? Soweit ich weiß, liege ich nicht auf Ihrer bescheuerten Couch.«
Ich nickte. Mir war klar, daß ich schon tiefer als geplant in Rustys verwinkeltes Unterbewußtsein eingedrungen war. »Sie haben recht. Ich lese nur noch schnell zu Ende.«
Ich blickte mit demonstrativ gesenktem Kopf in die Akte, damit sie mir nicht mehr vorwerfen konnte, daß ich sie anstarrte.
»Und wie können Sie behaupten, daß ich nie genug bekommen 1 habe? Ihr Psychiater denkt wohl, ihr hättet die Weisheit mit Löffeln gefressen!«
Ich warf einen Blick auf ihre Füße. Sie rührten sich nicht. Sie sehnte sich regelrecht nach der Couch. Tief in seinem Innersten möchte jeder Mensch die Wahrheit sagen.
»Wahrscheinlich kommen Sie aus reichem Hause, Doc«, stichelte sie weiter. »Mein Vater hatte drei Jobs, um die Familie ernähren zu können.«
Ich schloß die Augen und hoffte, sie würde endlich aufhören.
»Mein Vater hat auch für uns gekocht. Also habe ich ausgezeichnet gegessen.« Sie ging noch immer nicht weiter. »Worauf wollen Sie also hinaus? Oder machen Sie sich über mich lustig?«
Widerwillig blickte ich auf. »Hat Ihre Mutter auch gearbeitet?« fragte ich.
Ich würde um das Gespräch wohl nicht herumkommen.
Sie schien überrascht. »Was?«
»Hatte Ihre Mutter einen Job?«
»Sie war nicht da. Aber ...«
»Warum nicht? Wo war sie denn?«
»Weshalb sollte ich Ihnen das erzählen?«
»Nur so. Natürlich müssen Sie nicht.«Aber
du brauchst es!
»Schon gut. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Nach meiner Geburt wurde sie krank
Weitere Kostenlose Bücher