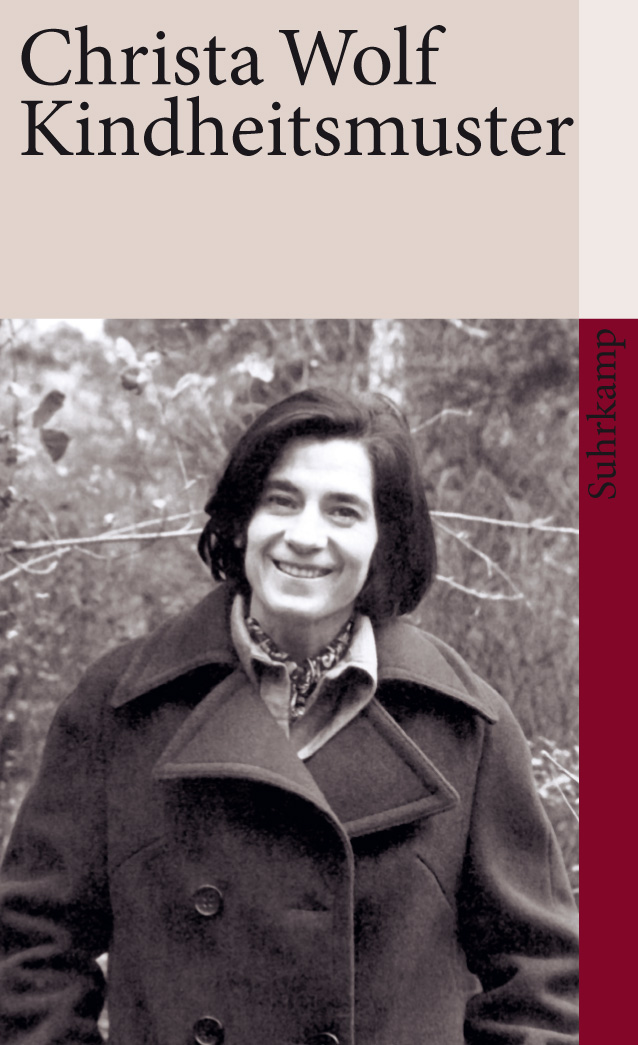![Kindheitsmuster]()
Kindheitsmuster
Seele gehalten.
Das Grundgerüst – man könnte auch Wahrnehmungsmuster sagen – solle man sich notfalls als ein Netz ausfest miteinander verbundenen Nervenfasern vorstellen, das allerdings tatsächlich in den ersten Lebensmonaten geknüpft wird: Später wächst das Gehirn nicht mehr. Es sei von Familie zu Familie, von Kultur zu Kultur unterschiedlich, je nach Art und Intensität der Kommunikation mit der Außenwelt, die der Fernsehwissenschaftler als »ausschlaggebend« bezeichnet. Übrigens aber stimme der Bauplan der zehn bis fünfzehn Milliarden Nervenzellen des Gehirns (deren jede mit zehn- bis fünfzehntausend anderen Zellen verdrahtet ist) bei allen Individuen der Gattung Mensch zu neunundneunzig Prozent überein. Die Unterschiede stecken im letzten Prozent.
In jenem Jahr 1937 ist also auf der ganzen beachtlichen Strecke von 500 000 Kilometern – so lang nimmt man ja die Nervenfasern zwischen den Zellen an, länger als die Verbindung zwischen Erde und Mond – bei den Individuen in Nellys Umkreis und bei ihr selbst das Signal »Angst« aufgeflackert, nicht aber der Reflex »Mitleid«, den wir uns phylogenetisch allerdings erst viel später erworben haben.
Was heißt denn das?
Das heißt anscheinend, daß die in der Hirnrinde – besonders im Stirnhirn – lokalisierten Reaktionen, die wir als »typisch menschlich« empfinden, unter gewissen Umständen zugunsten der vom Stammhirn aus gesteuerten Reflexe entfallen (abgeworfen, getilgt, verlernt werden; verblassen, entschlüpfen, entschwinden; überlebt, überholt, einfach weg sind: verschollen. Tertiär). Schwamm drüber. Aus den Augen, aus dem Sinn. Papierschiffchen auf dem breiten Strom Lethe.
(Was heißt: sich verändern? Die unkontrolliertenReflexe des vor-menschlichen Stammhirns beherrschen lernen, ohne sie durch brutale Unterdrückung bösartig zu machen?)
Warum sie nicht gelitten haben? Die Frage ist falsch gestellt. Sie litten, ohne es zu wissen, wüteten gegen ihren Körper, der ihnen Signale gab. Mir springt der Schädel. Ich ersticke.
(»Wenn die Funktionen der Hirnrinde ausgeschaltet werden, dann geht das Erinnerungsvermögen verloren. Aber auf äußere Reize vermag auch ein derartiges Individuum noch zu antworten. Wenn wir es stechen, zuckt die entsprechende Extremität zurück, wenn wir ihm ins Auge leuchten, schließt es die Augenlider, und die Pupillen verengen sich, und wenn wir ihm Essen in den Mund stecken, beginnt es zu essen.«)
Die Straße, an der das Haus liegt, das einst Jordans gehörte, heißt jetzt »ulica Annuszka«. Der Name gefällt euch beiden, Lutz und dir. Ihr überlegt, ob Annuszka, das man womöglich auf der ersten Silbe betont, ein Mädchenvorname sein könnte.
Aus der Schlucht kommend, seid ihr wieder eingestiegen. Das Auto ist eine Hitzekammer. Alle Fenster heruntergekurbelt, fahrt ihr in Richtung Stadion und Walter-Flex-Kaserne. »Wildgänse rauschen durch die Nacht«, erinnert Lutz. Eine Kaserne, die nach einem Dichter heißt. H. kennt das ganze lange Gedicht über Hermann Löns auswendig, zitiert es, durch übertreibende Betonung Distanz andeutend: »Als Hermann Löns aus der Heide nach Frankreich zog, / Markwart, der Häher, ihm schwatzend zur Seite flog. / Löns –! Wohin? In den Krieg und fast fünfzig Jahr? / Unterm Rekrutenhelm ergraut dir das Haar!«
Ist ja schon gut, sagt Lenka. Sie liebt es nicht, daß ihre Eltern solche Zeilen aufsagen. Guckt mal her. Guckt euch das mal an und sagt mir mal, wer solche Fotos macht.
Sie hat in der Zeitung ein Foto gefunden. Eine alte Vietnamesin ist zu sehen, an deren Schläfe ein G. I. seinen Gewehrlauf hält, den rechten Zeigefinger auf Druckpunkt am Abzugshahn.
Solche Fotos, sagt ihr, machen Leute, um damit Geld zu verdienen. Warum, fragt Lutz, hältst du dich mit deiner Wut nicht an den Soldaten?
Lenka ist ein Kind des Jahrhunderts. Sie weiß, es gibt Mörder, und interessiert sich nicht für deren Innenleben. Was einer empfindet, der die Mörder bei ihrer Berufsarbeit fotografiert, anstatt ihnen in den Arm zu fallen: Das möchte sie wissen. – Nichts, sagt ihr. Vermutlich nichts.
Schweine, sagt Lenka. Sie kann nie lange auf Bildoder Filmdokumente starren, die Folterszenen zeigen oder Sterbende oder Selbstmörderinnen am Dachrand des Hochhauses. Immer muß sie an den Mann denken, der hinter der Kamera steht und dreht oder knipst, anstatt zu helfen. Sie lehnt die gängige Einteilung ab: Einer muß sterben, ein zweiter bringt ihn dazu, der dritte aber steht
Weitere Kostenlose Bücher