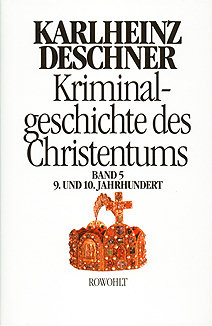![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
den Kahlen die päpstlichen Wünsche nicht. Vielmehr verband er sich mit dem Normannenführer Rorich, der, inzwischen zwar Christ, gleichwohl »die Geißel der Christenheit« blieb – wie ja auch sonst Christen einander solche Geißeln seit Jahrhunderten waren, fort und fort blieben und bleiben. Als freilich der überraschend genesene Ludwig der Deutsche dem Usurpator mit Krieg drohte, ihm auch gleich entgegenrückte, lenkte Karl ein.
Nach längeren Vorverhandlungen kamen beide Könige bei Meersen zusammen (am Maasufer in den Niederlanden, wo sich um die Mitte des Jahrhunderts schon mehrfach fränkische Fürsten verabredet hatten) und teilten am 8. August 870, genau ein Jahr nach Lothars II. Tod, kurzerhand dessen Reich nördlich der Alpen gleichmäßig unter sich auf; wobei Maas, Mosel und Saone ungefähr die Grenze bildeten – bis zehn Jahre später freilich durch die Verträge von Verdun (879) und Ribemont (880) der ganze westliche Teil Lotharingiens wieder Ostfranken zufiel. 35
Weitere Proteste des Papstes hinkten nur hinter dem Vollzogenen her. Doch weder Karl der Kahle, der »zum drittenmal Gemahnte«, noch der wohl am meisten abgekanzelte Erzbischof Hinkmar, den der Römer, vermutlich zu Recht, geradezu den Initiator des Bösen, des Raubes schimpfte, noch die übrigen Prälaten scherten sich sehr darum. Vielmehr hörte der Heilige Vater bald darauf von Karl, daß die Frankenkönige in ihren Ländern herrschten und nicht die Bischöfe, weshalb er denn auch gelassen annektierte, was ihm der Teilungsvertrag von Meersen eingebracht.
Wie Hadrian aber schon gegenüber Lothar und Waldrada nachgeben mußte, so auch in anderen Konflikten, in zivilen und kirchlichen Streitfällen im Karolingerreich, zumal in einem Zerwürfnis des Bischofs Hinkmar von Laon und seines mächtigen Onkels Hinkmar von Reims sowie Karls des Kahlen. Man verwahrte sich gegen Einmischungen, zu denen er nicht befugt sei. Ganz massiv verbat sich Karl römische Befehle, die in seine Rechte eingriffen. Der Papst mußte sogar persönliche Briefe verleugnen, die sein Sekretär geschrieben hatte. Sie seien ihm, erklärte er, während seiner Erkrankung entrissen, ja, sie seien erdichtet worden. Auch eine Synode von 30 fränkischen Bischöfen ergriff Partei für den König.
Kaiser Ludwig II. stirbt erschöpft für Christus, und die Kirche beerbt ihn
Nun schien seinerzeit wenigstens im Süden Italiens sich ein Lichtblick zu bieten. Gelang es doch endlich Ludwig II. nach mehrjähriger Belagerung 871 Bari, das Sarazenenzentrum auf der Halbinsel, den Sitz eines arabischen Emirs, mit byzantinischer Hilfe zu erobern. Freilich konnte der Kaiser auch im selben Jahr durch den Herzog Adelchis von Benevent in einem Handstreich gefangen genommen werden, wonach er seine beherrschende Stellung verlor, allerdings weniger wegen solcher als infolge mißlicher dynastischer Umstände. Seine Frau Angilberga, der einst fränkischen Sippe der Suponiden entstammend, war zwar ungewöhnlich aktiv an seiner Regierung beteiligt, selbst (besonders seit seiner Erkrankung und Jagdverletzung 864) an militärischen Aktionen, hatte ihm aber nur zwei Töchter geboren. Ihr Versuch, nach Eintritt des Erbfalls Italien samt Kaiserkrone den ostfränkischen Karolingern zuzuspielen, mißlang durch den Widerstand des oberitalischen Adels, der sich mehrheitlich für Karl den Kahlen entschied. Und der Papst stellte jetzt in einer jähen politischen Wendung Karl sogar die Kaiserkrone in Aussicht. 36
Kaiser Ludwig II. (855–875), Lothars I. ältester Sohn, hatte fast sein ganzes Leben in Italien verbracht. Im Süden des Landes rivalisierten byzantinische und langobardische Machtinteressen, dazu gab es zahlreiche lokale Zwistigkeiten – alles selbstverständlich Wasser auf die Mühlen der Sarazenen, gegen die Ludwig 866 sämtliche freie Männer Italiens aufgerufen. Oft gelobt und immerfort angefeuert von den Päpsten, führte er häufig Krieg, unterwarf die Herzöge von Salerno, Benevent, Capua, kämpfte lange in Apulien und konnte so sein Kaisertum natürlich nur in Reichsitalien, nicht aber nördlich der Alpen zur Geltung bringen, wo im »Mittelreich« seine Brüder Lothar II. und Karl von der Provence herrschten, so daß ihn Erzbischof Hinkmar von Reims geringschätzig »imperator Italiae« nannte. Und schließlich mußte er auch noch den Süden sich selbst überlassen, vor allem wegen der Feindseligkeit seiner christlichen Fürsten, zumal auch des oströmischen Kaisers.
Ludwig II., der
Weitere Kostenlose Bücher