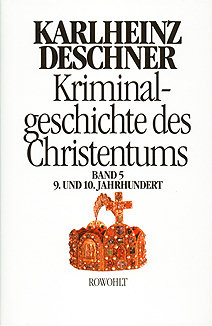![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
firmierte, am 15. Oktober 879 in der (heute gänzlich verschwundenen) Pfalz Mantaille, südlich von Vienne (bei Anneyron, Dép. Drôme), zum König in Burgund und in der Provence wählen – zu einer Art »Pfaffenkönig«, denn er wurde, in enger Anlehnung übrigens an die Bischofswahl, nur vom Klerus proklamiert, von 27 Erzbischöfen und Bischöfen, und dann gesalbt, alles natürlich kraft göttlicher Eingebung.
Ein Vorgang von weittragenden Folgen. Denn die Prälaten aus dem Rhoneraum mißachteten dabei Bosos mangelnde Legitimität, mißachteten die ostfränkische Karolingerdynastie und deren »Geblütsanspruch« überhaupt. Wurde damit doch erstmals seit 130 Jahren das alleinige Anrecht der Karolinger auf eine Krone durchbrochen. Boso hatte die jugendlichen Söhne des Stammlers ignoriert, sie »für nichts«, als »unechte Kinder« angesehen, sei ihre Mutter ja auf Karls Befehl (S. 247, 251) »abgelehnt und verstoßen worden« (Regino von Prüm). Und Bosos ehrgeizige Gattin Ermengard wollte gar nicht mehr länger leben, könnte sie, Tochter eines Kaisers und Braut eines Kaisers – man hatte sie 866 mit Basileios I. (S. 261) verlobt – nicht ihren Mann zum König machen.
So warf Boso mit Geschenken um sich und gelobte, in allem nach dem Wunsch des Klerus zu verfahren. Ganz beiseite, daß viele Bischöfe nicht nur »durch Versprechungen von Abteien und Landbesitz«, sondern auch »durch Drohungen« (Annales Bertiniani) gefügig gemacht worden waren. Bedenkenlos hat dann Boso auch Klostergüter und Reimser Kirchenbesitz geraubt, sich sogar an dem päpstlichen Krongut Vendeuvre vergriffen, um die einflußreichsten Prälaten und Vasallen befriedigen zu können, Leute, die einmal mehr electio per inspirationem vorgaukelten, indem sie behaupteten, Bosos Wahl habe ihnen, kraft ihres brünstigen Gebetes, Gott eingegeben. Denn den Electus als von Gott Prädestinierten hinzustellen, war »schon beinahe phrasenhaft geworden« (Eichmann) – und erstunken und erlogen war es allemal. »Nicht nur in Gallien«, rühmten die Bischöfe Boso, »sondern auch in Italien leuchtete er allen voran, so daß der römische Papst Johann, ihn gleich einem Sohne achtend, seine lautere Gesinnung mit vielem Lob pries ...« Und der Mörder seiner ersten Frau, der Räuber seiner zweiten bekannte seinen alleinseligmachenden katholischen Glauben, unterwarf sich dankbar der Aufsicht der Kirchenfürsten und versprach, ihre Privilegien zu schützen.
In Lyon, der größten Stadt des neuen Reiches, krönte Erzbischof Aurelian den Boso zum König – keiner dank seiner Geburt, seines Erbrechts, sondern dank des Klerus, der sich dabei offenbar an Papst Johann orientierte. Denn wie der sich herausnahm, einen Kaiser als Schirmherrn zu wählen, so beanspruchten auch sie nun das Recht, einen Beschützer nach Gutdünken zu küren, natürlich zu ihrem größtmöglichen Vorteil. Die Frankenkönige einigten sich zwar gegen den Usurpator und eroberten im Sommer 880 die Festung Mâcon an der Sâone, vermochten indes Vienne nicht zu nehmen, da Karl überraschend die Belagerung abbrach, um nach Italien zu ziehen. Und Boso behauptete sich gegen den Widerstand der west- wie ostfränkischen Karolinger bis zu seinem Lebensende am 11. Januar 887. 18
Den Kaiser will »zuerst und allermeist« Papst Johann berufen
Auf dem Recht zur Kaiserwahl und -krönung aber bestand der Papst. »Denn derjenige«, schrieb Johann einmal dem Erzbischof Ansbert von Mailand, »welcher von uns für das Kaisertum zu weihen ist, muß zuerst und allermeist von uns berufen und erwählt sein.«
Jahrhundertelang jedoch hatte der römische Bischof in dieser Frage überhaupt kein Mitsprache-, geschweige ein Entscheidungsrecht. Jahrhundertelang war er, wie alle anderen Patriarchen und Bischöfe, der Untergebene des Kaisers, war dieser sein Oberherr. Und kein Geringerer als Leo I. (440–461), »der Große« (als einziger Papst, neben Gregor I. und dito »Großen«, mit dem raren und höchsten Titel der Catholica, dem eines Kirchenlehrers bedacht), sprach dem Kaiser sogar das Recht zu, Dogmen betreffende Konzilsbeschlüsse zu kassieren. Nicht genug, er konzedierte ihm – und keinesfalls nur einmal! – Unfehlbarkeit, Irrtumslosigkeit
im Glauben,
während es seine, des Papstes »Pflicht« sei, »zu offenbaren, was du weißt, und zu verkünden, was du glaubst ...« (II 254 f.).
Difficile est satiram non scribere.
Noch Karl I. hatte sein Kaisertum durch eigenes Machtbewußtsein an seinen Sohn
Weitere Kostenlose Bücher