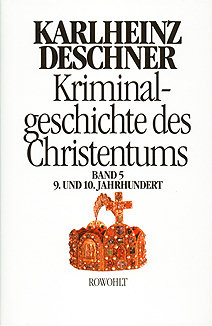![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Zeit, erwachsen auf dem Boden des feudalen Aufbaus der Gesellschaft ...«
L.M. Hartmann 4
1. Arnulf von Kärnten: Ostfranken und der Osten
Arnulf »von Kärnten« (um 850–899) war der älteste außereheliche Sproß des Bayernkönigs und Königs von Italien, Karlmann, des ältesten Sohnes von Ludwig dem Deutschen und seiner Mutter Liutwind, offenbar einer Luitpoldingerin. Neben seiner rechtmäßigen Gattin Ota beglückte Arnulf mehrere Kebsweiber, hatte auch an außerehelichen Kindern keinerlei Mangel, was den Klerus aber nicht störte. Vielmehr wurde der durchaus kirchenfromme Fürst von der Gemeinschaft der Heiligen ebenso begünstigt, wie er sie begünstigte, auch wenn er auf eine Salbung verzichtet hat.
»Heil Arnolf, dem großen König«
Von Anfang an bestand ein enges Verhältnis zwischen den Bischöfen und dem neuen Herrn, der sich selbst einmal den »entschlossensten Gegner« aller Kirchenfeinde, in einer Urkunde »Sohn und Verteidiger der katholischen Kirche« nennt, der er auch nach seiner Erhebung gleich durch Schenkungen und Gnadenerweise seine Gewogenheit signalisierte. »Auffallend großzügig« stattet er die Bischöfe mit Königsgütern, mit Forsten, Münz-, Markt- und Zollrechten in einer »zuvor unbekannten Häufigkeit« aus (Fried). Fünf Synoden berief er in seiner nur gut 12jährigen Regierungszeit ein. Die Autorität der Prälaten war ihm erwünscht gegen die aufsteigenden partikularen Gewalten. Überdies konnte sie sein illegitimes Königtum sanktionieren.
Der Kirche andererseits nützte die Macht des Herrschers in der Auseinandersetzung mit den Herzögen und dem hohen Erbadel. Deshalb förderte auch sie ihn sofort, ließ sie von Anfang an für ihn beten und verwandte sich unverzüglich unter Androhung kirchlicher Strafen für seinen Schutz. Aber selbstverständlich machte sie ihm auch die Pflichten eines christlichen Regenten klar. Und indem sie diesen stützte, stützte sie sich selbst. So setzte eine Entwicklung ein, die der Kirche – mit all den daraus resultierenden fatalen Folgen – mehr Mitsprache einräumte als je zuvor, die sie »zum mächtigsten Faktor im Staatswesen machte« (Mühlbacher). 5
Während Grafen in der Umgebung des Königs jahrelang gar nicht mehr nachweisbar sind, gibt eine Reihe von ihm vielfach bevorzugter Bischöfe politisch fortwährend den Ausschlag. Erst Erzbischof Thietmar von Salzburg, Arnulfs Erzkaplan, Leiter der Hofkapelle und Kanzlei; später immer mehr der Kanzler und Diakon Aspert, von Arnulf 891 zum Bischof von Regensburg gemacht, und dessen Kanzler-Nachfolger (seit 893), Bischof Wiching von Neutra (S. 231 f.). Ein maßgeblicher Politiker in Herrschernähe war der ebenso intelligente wie verschlagene Hatto I. von Mainz, dessen Tod (913) mancher einem rächenden Blitzstrahl zuschrieb. Hatto entstammte einem schwäbischen Geschlecht, Parteigängern Karls, stand aber nach des Kaisers Sturz gleich auf der Seite Arnulfs, von diesem dafür mit den Abteien Reichenau, Ellwangen, Lorsch und Weißenburg, 891 mit dem Erzbistum Mainz belohnt. Der Prälat begleitete den König zweimal nach Italien und griff in alle bedeutenden öffentlichen Fragen ein. Beachtliches politisches Gewicht hatten auch die Bischöfe Salomon III. von Konstanz (seit 884 Notar, seit 885 Kanzler Karls III., 888 schon Kapellan Arnulfs!), ferner Waldo von Freising, Erchanbald von Eichstätt, Engilmar von Passau, der hochadelige Adalbero von Augsburg, den Arnulf zum Erzieher seines Sohnes machte. 6
Im Mai 895, auf der Reichsversammlung zu Tribur, der Königspfalz bei Mainz, auf einer der größten und glänzendsten Synoden des Jahrhunderts, feierte der ungewöhnlich zahlreich tagende ostfränkische Episkopat Arnulf überschwenglich als den König, »dessen Herz«, so die Synodalakten, »der heilige Geist mit Feuer entflammte und mit dem Eifer der göttlichen Liebe entzündete, damit die ganze Welt erkenne, daß er nicht von einem Menschen und durch einen Menschen, sondern durch Gott selbst erwählt worden ist«.. Alte Sprüche der Prälaten. Denn wen sie wählen, sie stützen, der ist immer von Gott – nämlich von ihnen!
Auf der Synode, laut Regino von Prüm »gegen sehr viele Weltliche abgehalten, die die Autorität der Bischöfe zu mindern strebten«, dachten diese desto eifriger, ihre Autorität zu erhöhen. So erörterten sie eingehend Rechtsstreite von Geistlichen und Laien, Mißhandlung von Klerikern, deren Verwundung oder Tötung, was anscheinend häufiger als früher vorkam
Weitere Kostenlose Bücher