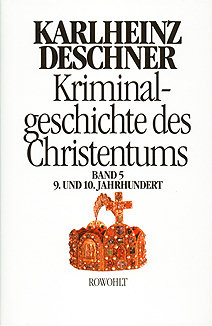![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
verschaffte sich so neue Vorteile gegenüber den stets unsichereren alten – der ewig gleiche Zug der Geschichte. Im übrigen wurde durch den dauernden Machtwechsel, die ständigen Positionskämpfe der hohe Adel immer stärker, gerieten die Könige unter seinen Druck und gewannen und behielten bloß durch ihn ihre Macht.
In unserer wichtigsten Quelle über diese ständigen dynastischen Zwiste, in den vier Büchern »Historien« des Nithard, bedauert dieser die innere Zerrissenheit, den Zerfall des Einheitsstaates, und erblickt das eigentliche Ideal in der Regierung seines »großen« Ahnen. So beklagt er am Ende des Werks die »wahnwitzige Vernachlässigung des öffentlichen Wohls«, »das selbstsüchtige Streben nach dem eigenen Vorteil«, hadert er, weil »von beiden Seiten Raub und Übel sich überall verbreiten«, und erinnert wehmütig an die Zeit »des großen Karl, glücklichen Andenkens«. Herrschte doch da »überall Friede und Eintracht ... nun aber ist überall Uneinigkeit und Streit zu sehen, weil jeder, wie er will, einen besonderen Weg geht. Und damals war allerorts Überfluß und Freude, jetzt aber ist nur Mangel und Trauer ...« 15
Diese Sätze, der noch heute herrschenden Historikeransicht konform, die Karls I. Staat als Einheitsstaat, aufstrebende Weltmacht, christliches Universalreich, als eine Art Weiterentwicklung der römischen Kaiseridee bejubelt, diese Sätze sind deshalb so bezeichnend, weil sie – »überall Friede« behaupten. Tatsächlich jedoch hatte Karls 46jähriges Regiment fast unentwegt Krieg, nahezu fünfzig Feldzüge gebracht, hatte er allein die Sachsen, die »Erzheiden«, dreiunddreißig Jahre mörderisch bekämpft! Was indes am Rand des immer weiter expandierenden Groß-Raub-Reiches geschah, betraf ja nicht den »Frieden« im Innern. Im Gegenteil. Je mehr »Ruhe und Ordnung« da, desto besser funktionierte das Töten, Versklaven, Annektieren dort, außerhalb der Grenzen. Doch »überall Überfluß und Fröhlichkeit« gab's nicht einmal hier, im Inland. Das genoß bloß die lächerlich kleine Schicht der Besitzenden, Adel und Klerus, die im fremden, im blutig geraubten Reichtum schwamm, während im schamlos geschröpften eigenen Volk chronische Unterernährung herrschte, Elend und Hungersnöte grassierten, die 784 in Gallien und Germanien ein Drittel der Menschen dahinrafften (IV 490).
Unter Karls Enkel trat lediglich anstelle des auswärtigen Kriegs der Krieg im Innern, der sogenannte Bürgerkrieg – freilich ein Pleonasmus, denn jeder Krieg ist Bürgerkrieg!
Natürlich war Nithards Sicht nicht exzeptionell.
Der Zeitgenosse Florus von Lyon, der dichtende Diakon, ein emsiger Kirchendiener, sieht das nicht anders. Auch er bedauert das dreifach gespaltene Imperium, die Herrschaft von Königlein statt eines Königs. Auch er glorifiziert »das Reich im Glanz der erhabenen Krone, / Herr war einer und eins auch das Volk, das dem Herren gehorchte ... / Friedlichkeit waltete drin und Tapferkeit schreckte die Feinde.« Und nachdem Florus noch den eignen, den »geheiligten Stand«, ganz christlich demütig gehörig herausgestrichen, preist er beredt das Verknechten im Osten, das Werfen der »Zügel des Heils um Besiegte«. »Hier bog heidnisches Volk sich dem Joche der Kirche, indessen / Dort der ketz'rische Wahn, mit Füßen getreten, dahinsank.« 16
Ja, das gefiel Christen immer: die Heiden im Joch, ihr Glaube mit Füßen getreten!
Die Verträge von Verdun (843) und Meersen (870)
Doch war man allgemein kriegsmüde. Das heißt: die Nachteile des Krieges wurden für die Mächtigen größer als die Vorteile; was nicht zuletzt auch für den hohen Klerus galt, dessen gewaltiger Besitz mit Vorliebe gebrandschatzt worden ist. Nach langen, schwierigen, von Mißtrauen gezeichneten Verhandlungen – gemischte Kommissionen, 120 Beauftragte hatten zuvor die Grenzen bereist und ermittelt –, nach Vorgesprächen im Juni 842 auf einer Saône-Insel bei Mâcon, im Oktober in Koblenz, im November in Diedenhofen, kam es im nächsten Jahr zu einer neuen Teilung.
Das Reich Ludwigs des Frommen wurde im Vertrag von Verdun, dessen Text unbekannt ist, im August 843 nach dem dynastischen Erbrecht, dem alten Grundsatz brüderlicher Gleichberechtigung, nach Ausscheiden allerdings von Bayern, Aquitanien und Italien, im Beisein der Magnaten, in West-, Ost- und Mittelreich gegliedert, in drei gleich große Länder – »ob die Könige wollten oder nicht wollten«.
Ludwig der Deutsche erhielt sein
Weitere Kostenlose Bücher