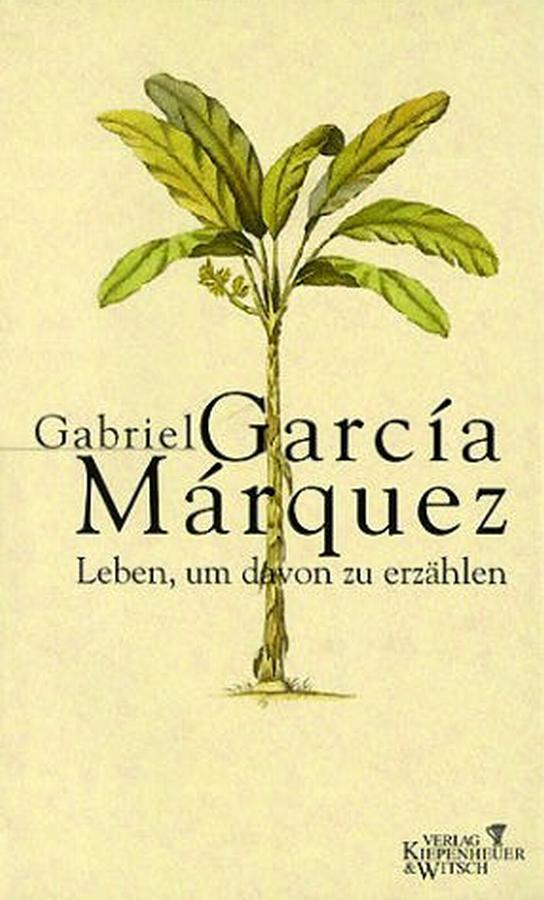![Leben, um davon zu erzählen]()
Leben, um davon zu erzählen
darüber zu schreiben schien mir ein Zeichen mangelnden Respekts. Seitdem verging jedoch kein Tag, an dem mir nicht der Wunsch zugesetzt hätte, diese Reportage zu schreiben. Viele Jahre später, ich hatte schon fast resigniert, wartete ich auf dem Flughafen von Algier auf den Abflug meiner Maschine. Die Tür der Wartehalle für die erste Klasse öffnete sich plötzlich, und herein schritt in der makellos weißen Tunika seines Adelsgeschlechts ein arabischer Prinz; auf der Faust trug er ein herrliches Wanderfalkenweibchen, das statt der Lederhaube der klassischen Falknerei eine mit Diamanten besetzte Goldhaube trug. Natürlich dachte ich an Cayetano Gentile, der von seinem Vater die hohe Kunst der Beizjagd erlernt hatte, erst mit einheimischen Sperbern und dann mit herrlichen Falken, die aus dem glücklichen Arabien angesiedelt worden waren. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte er auf seinem Gut ein professionelles Falkengehege mit zwei Falkenweibchen und einem Männchen, die für die Rebhuhnjagd abgerichtet waren, und einem schottischen Turmfalken, dressiert zur persönlichen Verteidigung. Ich kannte zu der Zeit schon das historische Interview, das George Plimpton mit Ernest Hemingway für The Paris Review geführt hatte. Es ging um den Vorgang, in dem sich eine Person aus dem wirklichen Leben in eine Romanfigur verwandelt. Hemingway sagte: »Wollte ich erklären, wie man das macht, so wäre das in manchen Fällen ein Leitfaden für Anwälte, die auf Diffamierungsfälle spezialisiert sind.« Seit jenem bedeutsamen Morgen in Algier galt für mich aber das Gegenteil: Ich fühlte mich nicht in der Lage, weiter in Frieden zu leben, wenn ich nicht die Geschichte von Cayetanos Tod niederschrieb.
Meine Mutter verweigerte sich jedem Argument und blieb fest entschlossen, diese Geschichte zu verhindern, bis sie mich in Barcelona dreißig Jahre nach der Tragödie anrief, um mir selbst die traurige Nachricht mitzuteilen, Julieta Chimento sei gestorben, ohne den Tod ihres Sohnes verwunden zu haben. Diesmal fand selbst meine Mutter mit ihrer eisernen Moral keine Gründe, die Reportage zu verhindern.
»Als Mutter bitte ich dich jedoch um eines«, sagte sie zu mir, »gehe es so an, als wäre Cayetano mein eigener Sohn.«
Der Bericht wurde unter dem Titel Chronik eines angekündigten Todes zwei Jahre später veröffentlicht. Meine Mutter las ihn nicht und gab dafür einen Grund an, den ich als weiteres Kleinod in meinem privaten Museum verwahre: »Was im Leben so schlecht ausgegangen ist, kann in einem Buch nicht gut ausgehen.«
Eine Woche nach Cayetanos Tod klingelte um fünf Uhr nachmittags, als ich gerade mein journalistisches Tagwerk in El Heraldo beginnen wollte, das Telefon auf meinem Schreibtisch. Es war mein Vater, der ohne Vorankündigung in Barranquilla eingetroffen war und mich dringend im Café Roma erwartete. Die Anspannung in seiner Stimme erschreckte mich, aber noch besorgter war ich, als ich ihn sah, unordentlich und unrasiert wie sonst nie. Er trug seinen von der Hitze der Landstraße mitgenommenen himmelblauen Anzug vom 9. April und schien nur gerade noch von der seltsamen Zufriedenheit der Besiegten aufrecht gehalten zu werden.
Ich war nach dem Treffen so erschlagen, dass ich heute kaum noch die Sorge und die Klarsicht vermitteln kann, mit der mein Vater mich über die katastrophale Lage der Familie unterrichtete. Sucre, das Paradies des leichten Lebens und der schönen Mädchen, war dem Erdstoß der politischen Gewalt erlegen. Der Tod von Cayetano war nur ein Symptom dafür.
»Du hast keine Ahnung, was das für eine Hölle ist, weil du in dieser Oase des Friedens wohnst«, sagte er. »Aber wir, die wir dort noch am Leben sind, sind das nur, weil Gott uns kennt.«
Mein Vater war eines der wenigen Mitglieder der konservativen Partei, die sich nach dem 9. April nicht vor den aufgebrachten Liberalen hatten verstecken müssen, aber er wurde jetzt von eben den Parteifreunden, die damals in seinem Schatten Schutz gesucht hatten, wegen seiner Lauheit angegriffen. Er malte mir ein derart erschreckendes - und realistisches - Bild von der Situation, dass seine überstürzte Entscheidung, alles aufzugeben, um die Familie nach Cartagena zu bringen, mehr als gerechtfertigt schien. Ich hatte keinen Grund und nicht das Herz, ihm zu widersprechen, dachte aber, ihn mit einer weniger radikalen Lösung als dem sofortigen Umzug beruhigen zu können.
Zeit zum Nachdenken tat Not. Wir tranken schweigend zwei Limonaden, jeder mit
Weitere Kostenlose Bücher