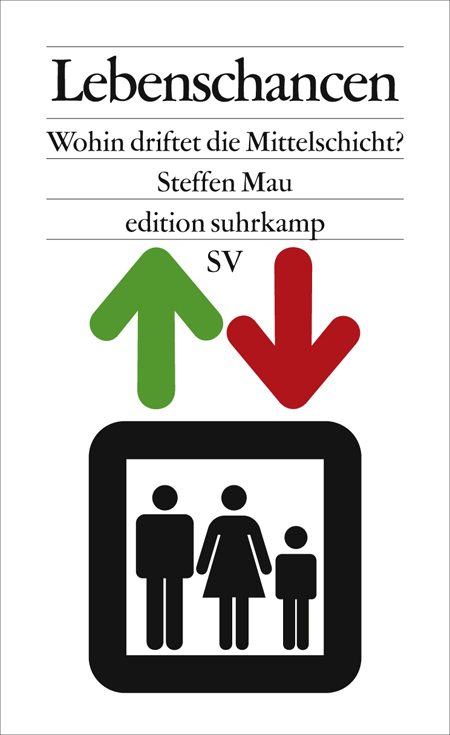![Lebenschancen]()
Lebenschancen
das eigene Kind tut, weil man die Fahrzeit zum Yoga oder die zusätzlichen Ausgaben für private Angebote scheut.
Dabei ist – wieder stoßen wir auf einen »Schleier des Nichtwissens« – längst nicht klar, ob die teuren Programme auch wirklich etwas bringen, Bildungserfolge lassen sich nämlich nicht so ohne größeren Aufwand messen und vergleichen. Zwar ergab die PISA -Studie, dass die Schüler von Privatschulen im Durchschnitt besser abschneiden als ihre Altersgenossen in öffentlichen Einrichtungen. Ein gutes Verkaufsargument für die privaten Anbieter? Hier muss man bedenken, dass Bildungserfolg in Deutschland – auch das ergab die Studie – eng mit der sozialen Herkunft zusammenhängt, und natürlich setzt sich die Schülerschaft von teuren Privatgymnasien anders zusammen; die Eltern verfügen in der Regel selbst über überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse. Doch für welche Unterschiede sind dann die Schulen und für welche die Schüler selbst (bzw. die Eltern) verantwortlich? Kontrolliert man den familiären und sozioökonomischen Hintergrund, schneiden Privatschulen nicht notwendigerweise besser ab als die öffentliche Konkurrenz (Weiß/Preuschoff 2006); sie mögen in bestimmten Bereichen wichtige Impulse geben, doch von einer allgemeinen Überlegenheit oder Vorbildfunktion kann nicht die Rede sein. Dennoch neigen Mittelschichteltern oft dazu, den Effekt einer Privatschule und ihres spezifischen Lernklimas zu überschätzen.
Zu diesen Unsicherheiten kommen nun auch noch mögliche Nachteile für die Kinder, die Eltern, die ihre Sprösslinge mit Nachdruck auf das Gleis zum Erfolg setzen wollen, ebenfalls abwägen müssen. Wohl jeder kennt aus dem privaten Be
kanntenkreis Fälle, in denen Kinder von allzu ehrgeizigen Eltern aufs Gymnasium geschickt werden, wo sie dann nicht mithalten können und unglücklich werden. Außerdem macht schon seit Längerem die Rede von den »verplanten Kindern« die Runde. Die haben ähnlich volle Terminkalender wie berufstätige Erwachsene, tingeln am Nachmittag von Kurs zu Kurs, und dabei bleibt dann die Zeit für Muße, zweckfreies Spielen und Selbstbestimmung auf der Strecke. Im Bestreben, ja alles richtig zu machen, beeinträchtigen Eltern nicht selten die Emanzipation und die Erfahrungsfähigkeit des Nachwuchses.
Wenn deutsche Mittelschichteltern, die mithilfe von »Bildungs- und Ausbildungszertifikaten« auf »soziale Selbstreproduktion« setzen (Münkler 2010: 70), viel Geld in die Hand nehmen, um ihren Nachwuchs vor den »Diversitätszumutungen« staatlicher Schulen, die auch von Kindern aus ärmeren Familien oder aus Familien mit Migrationshintergrund besucht werden, zu schützen, so hat dies schließlich auch problematische Folgen für die Gesellschaft insgesamt. Das Schulgeld kann insofern in gewissem Sinne auch als »Segregationsprämie« verstanden werden (Bude 2011: 17). Verbesserte Chancen für das eigene Kind gehen oft mit sozialer Schließung einher. Bildungsentscheidungen der Mittelschicht mögen individuell rational sein; gesamtgesellschaftlich hängen sie eng mit einer »Entmischungs- und Vermeidungslogik« zusammen (Knötig 2010: 339).
Stadtquartiere und Einkommensgrenzen
Wenn man Menschen fragt, in was für einer Nachbarschaft sie gerne leben würden, geben sie häufig an, dass sie sich eine bunte Mischung wünschen. Das klingt nach dem alten sozialdemokratischen Ideal einer Gesellschaft, in der Arbeiter und Akademiker, Migranten und Einheimische, Alte und Junge Tür an Tür miteinander leben. In Zeiten, in denen das Statusbewusstsein
wichtiger wird, entspricht dieses Ideal allerdings immer seltener der Realität: Gruppen und Milieus grenzen sich räumlich voneinander ab, in vielen Städten dominiert nicht das Miteinander, sondern das Nebeneinander.
Der Stadtsoziologe Robert E. Park, ein Mitbegründer der sogenannten Chicago School, ging bereits in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts davon aus, dass sich gesellschaftliche und ökonomische Hierarchien oft in homogenen Wohnquartieren widerspiegeln. Er sprach von »residentieller Segregation« (Park et al. 1925); tatsächlich sind derartige »Sortierprozesse« – »big sort« genannt (Bishop 2008) – in den Vereinigten Staaten sehr ausgeprägt, und auch in Deutschland gewinnt die innerstädtische Differenzierung an Dynamik (Friedrichs/Triemer 2008). Neben den traditionellen Refugien der Oberschicht entstehen sozial weitgehend homogene Altbauviertel mit schicken kleinen Boutiquen,
Weitere Kostenlose Bücher