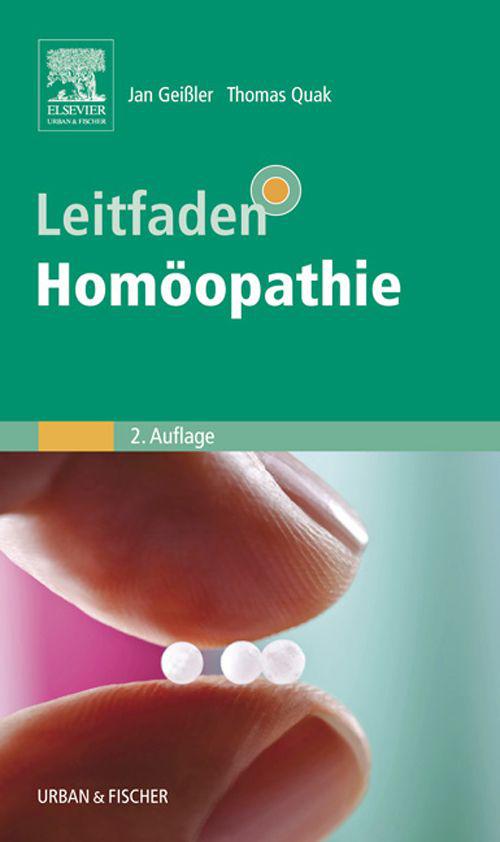![Leitfaden Homöopathie (German Edition)]()
Leitfaden Homöopathie (German Edition)
Bestehen.
Sulfur:
Chronisches Mittel zu
Aconitum
, bewährt sich, wenn andere Mittel – obwohl korrekt gewählt – nicht wirken. Patienten (Eigenbrödler) sind tags reizbar, nachts unruhig; Schleimhäute sind gerötet, trocken, jucken; stechende Schmerzen. Amalgamfüllungen kontrollieren.
Zincum sulfuricum:
bei roten Lidwinkeln und Hornhautmitbeteiligung.
Weitere Indikationen
Vor dem ersten Lebensjahr bewährt sich oft
Calcarea carbonica
, bei zartgliedrigen, lebhaften älteren Kindern
Calcium phosphoricum.
26.7 Uveitis
Ursachen: allergisch-hyperergisch (immunologisch), z.B. Reaktion auf Bakterientoxine, Begleiterkrankung bei allgemeinen oder immunologischen Erkrankungen; bei einigen Uveitisformen sind HLA-Antikörper nachweisbar.
Verlaufsformen
Iritis (vordere Uveitis): tritt am häufigsten und meist akut auf. Symptome: dumpfe Schmerzen, Sehverschlechterung, Lichtscheu und Tränenfluss.
Zyklitis (intermediäre Uveitis): durch Glaskörpertrübungen gekennzeichnet, meist von einer Iritis begleitet. Oft chronische Verläufe mit Rezidiven.
Chorioiditis (hintere Uveitis): gekennzeichnet durch unscharf begrenzte, weiße, ödematöse Herde mit Exsudation in den Glaskörper, meist mit einer Retinitis kombiniert. Die Patienten sind schmerzfrei. Entsprechend der Lage der Entzündungsherde reduzierte Sehschärfe. Die Glaskörpertrübungen verursachen Schleier, die den Augenbewegungen folgen.
Panuveitis (anteriore und posteriore Uveitis). Rezid. chronische Uveitis anterior und posterior (vordere und hintere Uveitis). Symptome: Beginn mit einer Iridozyklitis (un-spezifische Entzündung infolge immunpathologischer Vorgänge). Die Folgen können bei der meist vorderen Uveitis u.a. Verwachsungen der Regenbogenhaut mit der Linse, zelluläre Mitreaktion des Glaskörpers und ein Sekundärglaukom sein. Schwerwiegender sind die Folgen der selteneren chronischen hinteren Uveitis, wobei Netzhautentzündungen, die Zerstörung des Glaskörpers (Glaskörperschrumpfung) und eine evtl. dadurch bedingte Traktionsamotio der Netzhaut im Vordergrund stehen. Der entzündliche, chronische Prozess führt nicht selten trotz aller therapeutischer Bemühungen zur Bulbusschrumpfung und funktionell zur Erblindung des Auges.
Therapeutische Strategie
Wegen möglicher Komplikationen wie z.B. Hornhautveränderungen, Katarakt, Seclusio pupillae, Sekundärglaukom, Amotio retinae, Phthisis bulbi ist eine augenärztliche Kontrolle in jedem Fall dringend erforderlich.
Schulmedizinisch besteht die Therapie der Wahl bei immunpathologisch bedingten Uveitiden in der Anwendung von Immunsuppressiva aufgrund ihrer antientzündlichen und immunsuppressiven Eigenschaften. Bei chronischen Verlaufsformen wird hier eine intensive und langfristige Behandlung mit Cortison, Imurek, Methotrexal, Cyclosporin A oder Ähnlichem empfohlen.
Eine homöopathische Behandlung ist möglich, sollte aber unter Berücksichtigung der oben genannten Komplikationen nur begleitend zur schulmedizinischen Therapie durchgeführt werden. Auch bei der rezidivierenden chronischen Uveitis ist eine homöopathische Behandlung nur unter kurzfristigen augenärztlichen Kontrollen durchzuführen. Lehnt der Patient cortisonhaltige Augentropfen des Augenarztes ab, können alternativ je nach den vorliegenden Symptomen lokal
Apis
,
Euphrasia
,
Formica
oder
Quarz
als Augentropfen verordnet werden.
Homöopathische Behandlung
In der Praxis zeigen sich Uveitiden oft als Symptom einer zugrunde liegenden allgemeinen Gesundheitsstörung (z.B. Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Kap. 12.3 ). Unabhängig von der Akuttherapie, die durch den Augenarzt erfolgt, kann konstitutionell homöopathisch behandelt werden. Bewährt hat sich hier die Empfehlung von Mathias Dorcsi, bei diesen Entzündungen eine Einmalgabe
Tuberculinum
C200 zu verabreichen. Über diese Empfehlung hinaus muss das individuell passende Konstitutionsmittel gefunden werden, um die Rezidivintervalle zu verlängern und den Visus zu erhalten. Ein Patient, der eine Uveitis durchgemacht hat, bleibt sein Leben lang ein – ggf. rezidivfreier – Uveitis-Patient.
Wahl der Symptome
Genaue Diagnose durch den Augenarzt (Iritis, Chorioiditis, Chorioretinitis, Iridochorioiditis etc.)
Schmerzcharakter mit Modalitäten (z.B. stechend, brennend, besser durch warme oder kalte Applikationen etc.)
Sehstörungen (Photophobie, Schleiersehen, Farbensehen etc.)
Symptome evtl. vorhandener Grunderkrankungen (z.B. Gelenkprobleme bei rheumatischen
Weitere Kostenlose Bücher