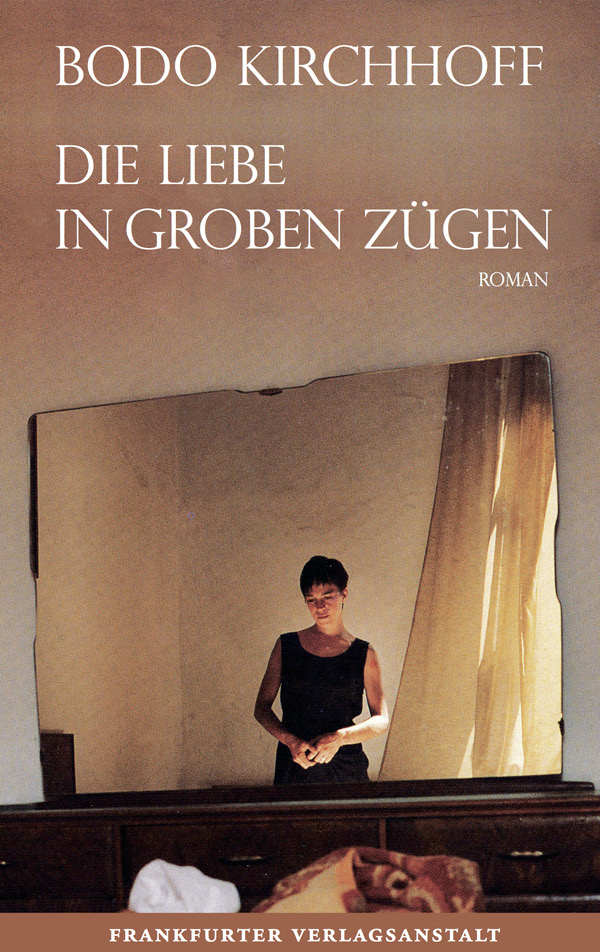![Liebe in groben Zügen]()
Liebe in groben Zügen
passierte, würde er noch ohne das Polster der Weisheit sterben. Nicht das wahre, das gefühlte Alter, von dem alle reden, flößte ihm Grauen ein. Er würde bis zum letzten Atemzug am Leben hängen, am Sehen, am Spüren, am Haben: dass er jemanden streicheln wollte und einen Mund wie Marlies’ Mund küssen, Blicke sehen wollte, die ihm galten, ihm allein, und den Sommer in seiner Fülle erleben, einmal und noch einmal und immer wieder, also eine Art Verzweiflung wie die des alten Gide im Eckbalkonzimmer vom Hotel Gardesana mit Blick auf den Hafen von Torri und auf den See am siebten September achtundvierzig, seinem Geburtsjahr, die Stelle in Gides Tagebüchern, die er immer wieder nachlas an dem Tag und schon auswendig kannte. Ich glaube aufrichtig zu sein, wenn ich sage, daß der Tod mich nicht allzusehr schreckt; aber ich sehe mit einer Art Verzweiflung den Sommer enden. Noch nie habe ich eine so lange Folge so schöner, so prächtiger Tage erlebt.
Wie eine latente Krankheit trug er diese Worte in sich, eine, die jederzeit ausbrechen konnte, ihn in den Griff nahm, und auch an dem Abend ausbrach. Er klammerte sich geradezu an Marlies, ein Kranker an eine Kranke, und sie schliefen zusammen, stumm, langsam, ja zögerlich, jeder den Kopf des anderen in Händen, ein Sichverlieren und in Gänze Lebendigsein im selben Moment, einem, den er schon nicht mehr erwartet hatte vom Leben. Und danach keine Flucht ins Bad, sondern ein Seite-an-Seite-Liegen, um neben- oder miteinander auch einzuschlafen, wie er und Vila Seite an Seite eingeschlafen waren, lange vor dem Haus am See, als Vila noch studierte und noch florierenden Zeitungen Porträts anbot, über besessene Theaterleute oder eine dichtende Stillsteherin, und er noch seine Filmkritiken für Feuilletons schrieb, betreut von ernsten Ressortleitern im Zigarettenqualm – wie aus einem anderen, verlorenen Leben waren diese Jahre, einer zerstörten Zeit.
Sie schliefen, bis es hell wurde in der Wohnung unweit des Arri-Kinos, immer noch nackt unter einer Decke: die Renz nur leicht anhob, um aufzustehen. Er ging duschen, er machte Frühstück und brachte alles ans Bett, ein Ei im Glas, zwei Stück Zwieback, grünen Tee, ein letzter Dienst vor der Rückfahrt. Du musst essen, sagte er, und Marlies bat ihn, nicht mehr zu kommen, wenn ihr die Haare ausfielen, demnächst in ganzen Büscheln, und sie trotz Essen immer magerer würde, ein Gespenst mit Kussmund, und er widersprach ihr oder ließ ein Versprechen aus sich herausrinnen wie einen vorschnellen Erguss: es sei ihm egal, wie sie aussehe, er werde sie besuchen, und von ihr eine Hand an seinem Hals, Du Lieber! Das Wort, das er mit auf die Fahrt nahm und das unterwegs immer schwerer wurde, so schwer, dass er mit Vila reden müsste, um nicht daran zu ersticken, auch wenn es kein Wort dieser Art gab, das er noch nicht verwendet hatte, das irgendwer zu irgendwem am frühen Abend gesagt hätte, nur war es in dem Fall ein Tagwort und so ernst wie alles, das bei Lichte geschieht, ohne die mildernden Umstände – Alkohol, Dunkelheit, laute Musik –, wie sie jeder Liebesgauner in Anspruch nimmt.
ABER Vila war gar nicht zu Hause, als Renz am Nachmittag ankam, sie war im Sender vor einem Riesenschirm, der jede Pore zeigte, und versuchte, das Fernández-Interview herunterzukürzen und dabei noch eine Begründung zu finden, warum das Ganze überhaupt gebracht werden soll, ein Gespräch von immerhin fünf Minuten mit einem alten Mann, der von anderen alten Männern erzählt, während die Zuschauer kurz vor Weihnachten wissen wollen, welche Bücher man gefahrlos verschenken kann. Es gab alle möglichen Begründungen für das Interview, politische, kulturelle, menschliche, nur keine, die Wilfinger gepasst hätten, nicht einmal für die vier Minuten dreißig, die am Ende übrigblieben, umrahmt mit zwei dreißig Havanna, inklusive Sonnenuntergang am Meer. Und selbst in diesem karibischen Rahmen war Pablo Armando Fernández noch kein deutscher Mitternachtstipp, da müsste sie schon im Off behaupten, dass er ein in Hollywood entlaufener Westernstar sei, halb kubanisch, halb jüdisch, einer, der nebenbei Gedichte schreibt und mit Fidel Castro und einem gewissen García Márquez auf seinem Sofa plaudert. Soll ich das tun?, hatte sie Bühl aus der Einsamkeit eines Redakteursbüros gemailt, und seine prompte Antwort: Ja, aber ohne Ironie.
Kurz darauf ging ihr Telefon, sie war sicher, dass er es sei, er mit Vorschlägen zur Nichtironie, also auch
Weitere Kostenlose Bücher