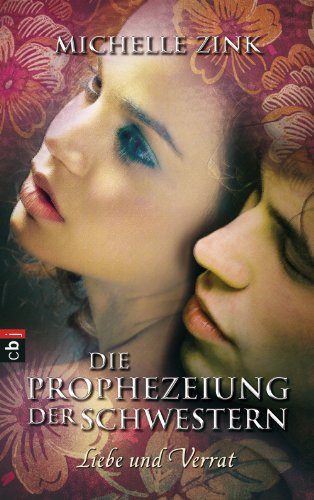![Liebe und Verrat - 2]()
Liebe und Verrat - 2
darüber nachzudenken, und schwinge mich langsam aus dem Sattel. Ich schwanke ein bisschen, als ich unten ankomme. Luisa kniet vor mir und packt meinen Fuß. »Komm, ich helfe dir.« Sie klopft mir seitlich gegen den Fuß, und gehorsam hebe ich ihn hoch, während ich mich gegen Dimitris Pferd lehne, um nicht umzufallen.
Sie zieht mir erst einen Stiefel samt Strumpf aus und dann den anderen. Der Sand drückt, körnig und kalt, gegen meine Fußsohlen. Luisa erhebt sich. Sie nimmt mich an der Hand und zieht mich wortlos in Richtung des Wassers.
Ich bin noch nicht gänzlich ein Sklave meiner Erschöpfung geworden. Als ich hinter Luisa her zur Brandung taumele, überlege ich, wie wir wohl nach Altus kommen sollen, wie unsere Reise weitergeht. Aber ich habe keine Lust, irgendwelche Fragen zu stellen oder auch nur lange über irgendetwas nachzudenken. Ich lasse mich von Luisa zu den rauschenden Wellen ziehen, bis sie meine Füße verschlucken. Das Wasser ist eiskalt, und ein Gefühl, eine Mischung aus Schmerz und Begeisterung, durchzuckt mich, während meine Füße von der glitschigen Glätte umspült werden.
Luisas Lachen wird vom Wind davongetragen, weit hinaus aufs Meer, so scheint es mir. Sie lässt meine Hand los und watet weiter hinaus, schaufelt eine Handvoll Wasser nach der anderen hoch und wirft es in alle Richtungen, wie ein Kind. Mit einem Mal spüre ich den Verlust von Sonia, denn sie sollte hier bei uns im Wasser sein, sollte mit uns lachen und staunen, was wir alles erreicht haben, wie weit wir gekommen sind. Wie nah wir Altus gekommen sind. Stattdessen ist sie eine Gefangene, beaufsichtigt von Edmund und Dimitri. Trauer und Groll kämpfen einen aussichtlosen Kampf in mir. Ich verliere, egal, was die Oberhand behält.
»Moment mal …« Luisa hält in ihrem Spiel inne. Sie steht ein paar Schritte von mir entfernt in den Wellen und blickt durch den Nebel in die Ferne. Ich folge ihrem Blick, aber ich kann nichts sehen. Die Nebelschwaden erstrecken sich bis zum Horizont und verschwimmen mit dem Grau des Meeres und dem Nichts des Himmels.
Aber Luisa sieht etwas. Sie starrt noch einen Moment länger hinaus aufs Wasser, dann wendet sie sich um.
»Edmund? Ist das …« Sie spricht nicht weiter, sondern dreht sich wieder dem offenen Meer zu.
Als ich mich meinen Gefährten zuwende, kommt Edmund langsam auf uns zu und blickt, wie Luisa, in die Ferne. Er stapft geradewegs ins Wasser, ohne sich darum zu kümmern, dass seine Stiefel ganz durchnässt werden. Neben mir bleibt er stehen.
»Ja, Miss Torelli. Ich glaube fast, Sie haben recht.« Und obwohl er Luisa anspricht, scheint es so, als spräche er zu sich selbst und gleichzeitig zu uns allen.
Ich wende mich ihm zu. »Womit hat sie recht?« Die Zunge liegt schwer und pelzig in meinem Mund.
»Mit dem, was sie gesehen hat«, sagt er. »Dort.«
Ich schaue in die Richtung, in die er deutet, und … ja, da ist etwas. Etwas Dunkles schiebt sich über das Wasser auf uns zu. Vielleicht liegt es am Mangel an Schlaf, aber plötzlich fürchte ich mich vor diesem Ding, das näher und näher kommt. Es ist monströs. Ein großes, bulliges Etwas, das mir wirklich und wahrhaftig Angst einjagt, nicht zuletzt, weil es sich völlig lautlos bewegt. Mir ist so, als müsste ich jeden Moment hysterisch anfangen zu schreien. Da gleitet das dunkle Ding durch die letzten dünnen Nebelschwaden zu uns heran.
Luisa grinst mich an. »Siehst du?« Sie verbeugt sich theatralisch und streckt den Arm zu dem Gefährt aus, das jetzt still auf den Wellen schaukelt. »Ihr Wagen wartet, Madame.«
Und dann begreife ich.
Wir heben und senken uns im Rhythmus der Wellen, und ich weiß nicht, warum ich glaubte, auf dem Rücken des Ozeans sei es besser als auf dem Rücken eines Pferdes. Wir sind schon eine ganze Weile auf dem Wasser, obwohl ich nicht sagen kann, wie lange genau. Der Himmel ist ebenso grau wie schon den ganzen Tag. Weder dunkler noch heller. Das Einzige, was ich guten Gewissens behaupten kann, ist, dass es nicht Nacht ist.
Ich gebe mir nicht einmal Mühe, den Verlauf unserer Fahrt zu verfolgen. Meine Müdigkeit sitzt zu tief, um einen klaren Gedanken zu ermöglichen, und der Nebel hat innerhalb kürzester Zeit die Küstenlinie verschluckt. Ich habe das Gefühl, dass wir nach Norden fahren. Das Schaukeln des Gefährts befördert mich so nah an den Rand des Schlafes, dass ich das irrwitzige Verlangen verspüre, ins Wasser zu springen, nur um dem hypnotischen Auf und Ab der Barke zu
Weitere Kostenlose Bücher