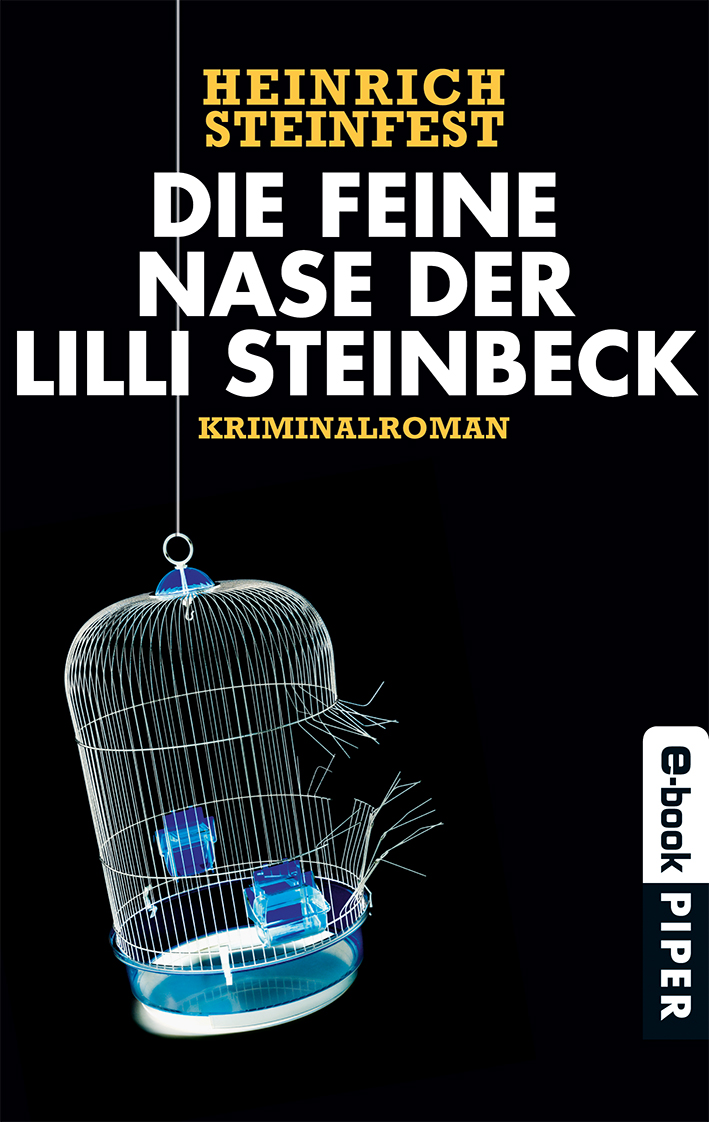![Lilli Steinbeck Bd. 1 - Die feine Nase der Lilli Steinbeck]()
Lilli Steinbeck Bd. 1 - Die feine Nase der Lilli Steinbeck
Universitätsprofessor verabredet, auf dessen Einladung Georg Stransky mehrmals in Athen gewesen sei.
»Gute Nacht!« sagte Steinbeck und zeigte vorwurfsvoll auf ihre Uhr. Es war fast zehn.
»Kali’nichta, gnädige Frau!« antwortete Stavros. Die Anrede verriet, daß er nun also doch erkannt hatte, es mit einer Österreicherin zu tun zu haben.
War das ein Grund für Lilli, sich zu freuen?
Oder war es ein Grund, sich zu ängstigen?
Steinbeck war erschöpft und deprimiert. Deprimiert wegen der späten Stunde. Ihr ganzer Rhythmus war dahin. Anstatt sich augenblicklich auszuziehen und mit der aufwendigen Abendtoilette zu beginnen, drehte sie den Dimmer ein wenig zurück und legte sich auf ein höchstwahrscheinlich fleischfarbenes Designerbett, das aber im bläulichen Licht die obligate grünliche Färbung angenommen hatte. Wie alles hier, vieles in Gelb und Rosa, aber eben eingegrünt. Jetzt im Dämmergrün.
Steinbeck lag gerade auf dem Rücken und dachte an Franz Schubert. An dessen Schöne Müllerin . An jenen Liedzyklus, den ihre Tochter über viele Jahre eingeübt hatte, anfangs mit der Gottergebenheit eines nicht sonderlich talentierten, aber vernünftigen Kindes, das begriffen hatte, daß auch Eltern, auch Adoptiveltern, ein wenig Freude im Leben verdienen. Nicht nur einen anstrengenden Job und ein sich ständig leerendes Bankkonto, sondern auch den Anblick einer musizierenden Tochter. Nach und nach hatte diese Tochter sich aber richtiggehend in Müllerinnen und Winterreisen und die ganze Wiener Klassik verliebt, ohne daß etwa dadurch ihr Talent zugenommen hätte. Aber Liebe hat natürlich wenig mit Talent zu tun. Im Gegenteil, gerade die talentiertesten Menschen erweisen sich unentwegt als die lieblosesten, selbst in ihrer Domäne noch. Was man sehr gut an sogenannten genialen Schubertinterpreten studieren kann. Null Liebe zur Musik. Null Liebe zu Schubert. Geniale Automatenmusik.
So daliegend, auf einem eigentümlich harten Bett, in all das Grün eingesponnen, erinnerte sich Lilli Steinbeck an ein von ihrer Tochter immer wieder vorgetragenes Lied: Die böse Farbe . Welches nicht unlogisch auf ein Poem folgt, welches den Titel Die liebe Farbe trägt. Und beide Male ist vom Grün die Rede.
Steinbeck sang leise, mit zuckenden, abwärts gleitenden Lidern: »Ach Grün, du böse Farbe du, was siehst mich immer an, so stolz, so keck, so schadenfroh, mich armen weißen Mann?«
Gleich darauf murmelte sie in den eigenen Schlaf hinein: »Bin nicht tot.«
Einen Moment später, der aber auch gut und gern eine halbe Nacht gedauert haben mochte, wurde Steinbeck aus ihrem Schlaf gezwungen. Sie wußte nicht gleich, was los war, wo sie sich eigentlich befand. Irgendein gewaltiges Ding drückte auf ihre Brust. Sie war kaum in der Lage zu atmen. Das Dämmergrün um sie herum wurde zur Decke hin von einem schwarzen Flecken unterbrochen. Dieser Flecken saß auf ihrer Brust. Der Eindruck von Tonnen relativierte sich nach und nach zu immer noch erheblichen achtzig, neunzig Kilo. Der Kerl, der auf ihr saß, mit seinem Hintern ihre Brust und mit seinen Knien ihre Arme fixierend, trug einen schwarzen, ledernen Anzug und hatte eine Batman-Maske übergezogen.
»Sehr witzig«, hätte Steinbeck gerne gesagt, aber sie bekam kein Wort heraus. Sie mußte froh sein, wenn sie nicht erstickte.
Der Unmensch begann zu sprechen, Griechisch, was sie nicht verstand. Aber sein Ton hörte sich ganz danach an, als wollte er ihr sagen, daß er sie noch blutig ficken würde, bevor es soweit wäre, ihr die Gurgel zuzudrücken.
Mein Gott, wie haßte sie diese Typen, auch wenn sie nicht gerade auf ihr saßen. Diese Typen, die Masken trugen und ihre Schwänze mit einer Feuerwaffe oder einem Giftstachel verwechselten. Sie hatte noch nie begriffen, was für eine Faszination von solchen Monstern ausging und wieso manche Ärzte auch noch Verständnis für deren Verhaltensweisen aufbrachten. Zumindest einen psychologischen Hintergrund sahen, eine traumatische Erfahrung, eine biographische Zecke.
Unsinn! Für Steinbeck existierte ein solcher Hintergrund nicht. Daß die Perversen je Opfer gewesen waren und einen an sich selbst erlebten Sadismus wiederholten, hielt sie für eine grandiose Lüge. Für eine Selffulfilling Prophecy von Psychiatern, deren Ehrgeiz es war, die Welt neu zu erfinden. Die Perversen sagten, was die Psychiater hören wollten. Die Perversen waren versierte Schauspieler. Das war ja ihr Tick, mit der Welt zu spielen, mit wehrlosen
Weitere Kostenlose Bücher