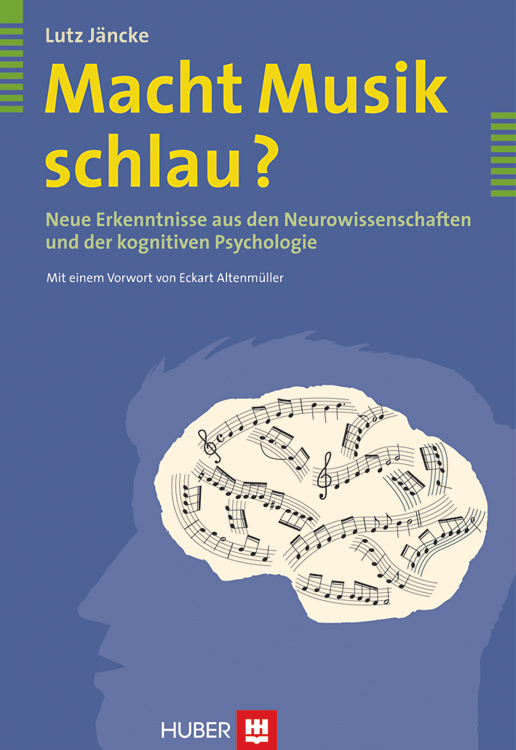![Macht Musik schlau?]()
Macht Musik schlau?
spielten, aber unterschiedlich hörten, sich sowohl in ihrer musikalischen Klangvorstellung unterschieden als auch in ihrer Musizierpraxis: Grundtonhörer spielten tendenziell lieber schwungvoll,virtuos oder rhythmisch betont, Obertonhörer interessierten sich mehr für zartere Klangfarbenänderungen, die Gestaltung einzelner Klangereignisse, einen weicheren Tonansatz, historische Aufführungspraxis oder die Hervorhebung von polyphonen Melodieverläufen.» (Schneider, Andermann, Engelmann, Schneider und Rupp, 2006). Dies ist eine ziemlich interessante Aussage, die zum Innehalten einlädt. Je nachdem, welche Strategie der Musiker wählt, um Klänge zu analysieren, bevorzugt er bestimmte Musizierstile. Das bedeutet, dass so etwas wie Anmutungsqualität und Musikgeschmack sehr stark mit kognitiven Analysestilen zusammenhängen. AuÃerdem würde dann der Musiziergeschmack bzw. Musizierstil auch von neuroanatomischen Besonderheiten abhängen. Allerdings wissen wir derzeit eigentlich nicht, ob die neuroanatomischen und neurophysiologischen Grundlagen bestimmen, ob man Grundtöner oder Obertöner wird und bestimmte Musizierstile bevorzugt. Es mag auch sein, dass aufgrund der intensiven Praxis eines bestimmten Musizierstils, ein Umstand der eher durch Stimmungen sowie Persönlichkeitseigenschaften beeinflusst wird, sich bestimmte neuroanatomische und neurophysiologische Veränderungen einstellen. Ein Musiker, der bevorzugt kurze Töne mit scharfen und abrupten Ãbergängen erzeugt, wird eher seinen linksseitigen Hörkortex häufiger stimulieren, während ein Musiker, der bevorzugt längere Töne mit charakteristischem Timbre erzeugt, demzufolge eher den rechten Hörkortex verstärkt stimulieren wird. Eine endgültige Entscheidung diesbezüglich wird die zukünftige Forschung in diesem interessanten Forschungsgebiet erbringen.
Abbildung 35: Anordnung der Obertöner und Grundtöner in einem typischen Orchester (nach Schneider et al., 2006).
Allerdings liefern die Heidelberger Kollegen in ihren Arbeiten schon Hinweise dafür, dass die spezifische Lernerfahrung bestimmt, ob man Grundtöner oder Obertöner wird. Sie berichten z.B., dass «sowohl die Dozenten als auch die Studenten der Heidelberger Kirchenmusikhochschule [â¦] bis auf wenige Ausnahmen alle Obertonhörer [waren], in Lübeck war hingegen die Mehrheit der gemessenen Kirchenmusikstudenten Grundtonhörer» (Schneider, Andermann, Engelmann, Schneider und Rupp, 2006). Zudem erwähnen sie weitere Beispiele, die belegen, dass die Neigung zum Grundtöner oder Obertöner von der jeweiligen «Schule» abzuhängen scheint. Ãhnliche Beobachtungen konnte ich in Zürich machen. Ich hatte eher den Eindruck, dass Jazz- und Popmusiker zur Grundtonanalyse neigen, während viele klassische Pianisten eher Obertöner waren, allerdings gab es auch bei den klassischen Pianisten Grundtöner. Mir ist jedoch der Fall eines Musikers bekannt, der sein Klavierstudium durch gelegentliche Auftritte im Tonstudie im Zusammenhangmit Pop-Plattenaufnahmen finanzierte. In diesem Genre hatte er sich auf die eher temperamentvollen «zackigen» Klaviereinlagen spezialisiert. Möglicherweise war er ein «Grundtöner», obwohl er sich im klassischen Musikstudium eher auf die «weicheren» und «zarten» Klavierstücke konzentrierte. Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie der Hörkortex dieses Musikers organisiert ist.
Die oben dargestellten Befunde bieten einen guten Eindruck des komplexen Zusammenwirkens neuroanatomischer und neurophysiologischer Besonderheiten des Hörkortex bei Musikern im Zusammenhang von Tonhöhen und Klangfarbenwahrnehmungen. Mittlerweile existieren einige neurowissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass bei Musikern Tonhöhen und Klangfarben anders verarbeitet werden als bei Nichtmusikern. Insbesondere elektroenzephalographische (EEG) und magnetenzephalographische (MEG) Studien sind hierbei sehr hilfreich gewesen. Da diese Untersuchungsmethoden für dieses Forschungsgebiet sehr wichtig sind, sollen sie hier etwas ausführlicher dargestellt werden.
Bei der EEG-Messung werden den Versuchspersonen kleine Elektroden auf der Kopfoberfläche angebracht. Dies bewerkstelligt man heute recht elegant mit Elektrodenkappen, die man den Versuchspersonen über den Kopf stülpt. In diese Kappen sind Halterungen für
Weitere Kostenlose Bücher