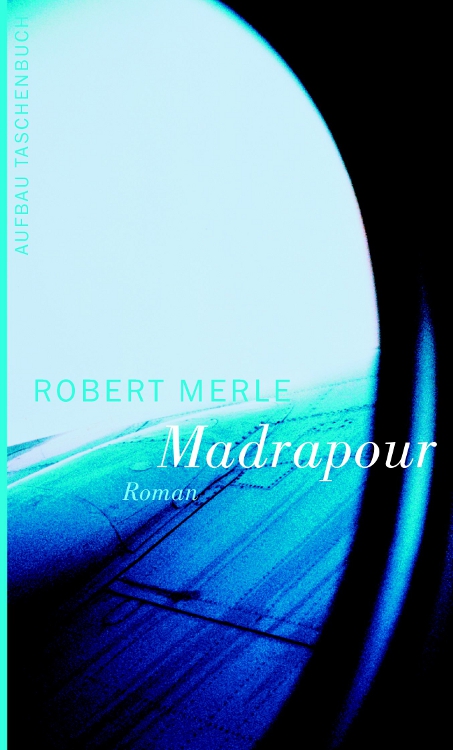![Madrapour - Merle, R: Madrapour]()
Madrapour - Merle, R: Madrapour
Monsieur«, erwidert die Stewardess ruhig. »Ich konnte nichts sehen. Das Licht war noch nicht wieder angegangen.«
An dieser Stelle erreicht unser Selbstbetrug seinen Höhepunkt – auch ich, der ich hier den Hellsichtigen spiele, habe es zunächst nicht bemerkt. Weil wir jetzt wissen, wo die Inder ausgestiegen sind und wie die Murzec wieder ins Flugzeug gelangt ist, reden wir uns ein, daß es keine Probleme mehr gibt und daß wir uns dem Schlaf überlassen können, nachdem sich die Dinge wieder normalisiert haben. Und ohne zu fragen, schaltet die Stewardess diesmal tatsächlich die Nachtbeleuchtung ein. Die Sessellehnen werden zurückgeschoben, zwei- oder dreimal muß jemand husten, Chrestopoulos schneuzt sich laut die Nase, und jeder scheint sich, ob allein oder zu zweit, von dem Kreis abzusondern, ihn jenes intensiven geselligen Lebens zu berauben, das ihn bislang beherrscht hat.
Die Ruhe kehrt nicht mit einem Schlage ein. Erst nach und nach hört das Flüstern auf zwischen Pacaud und Michou, Mrs. Boyd und Mrs. Banister, Madame Edmonde und Robbie, der Stewardess und mir.
»Pscht!« sagt die Stewardess zu mir. »Schlafen Sie jetzt.«
Um den Befehl zu mildern, überläßt sie ihre zarten Fingermeiner Pranke und schenkt mir einen mütterlichen Blick, der mich vierzig Jahre zurückversetzt, als ich ein kleiner Junge war und im Gitterbett lag. Und tatsächlich bin ich trotz meines Alters, meines Äußeren und meiner Hünenhaftigkeit ein Kind geblieben, dem es genügt, von einer sanften Hand und freundlichen Augen beruhigt zu werden. In Gedanken schmiege ich mich an die Stewardess wie an einen kleinen Plüschbären und stelle mich darauf ein, mir das Bewußtsein von den Dingen entgleiten zu lassen. Seltsam, daß eine Hälfte unseres Lebens Schlaf ist und von der verbleibenden Hälfte wiederum die Hälfte Vergessen oder Verblendung gegenüber der Zukunft.
So nähert man sich stufenweise unmerklich dem Tode: indem man die meiste Zeit davon träumt, zu leben. Offenbar ein guter Trick, da wir ihn alle anwenden. Man kann sich auch damit helfen, daß man wie ich an ein Jenseits glaubt. Aber das funktioniert nicht so gut. Der Gedanke, eines Tages den eigenen Körper zu überleben, ist nicht sehr tröstlich. Vor allem nicht im Augenblick des Einschlafens.
Vielleicht ist es doch ein Glück, daß wir die paar Stunden Nachtruhe hatten – auch für Bouchoix, der mir im Halbdunkel beim Einschlafen bleicher und leichenhafter denn je erscheint. Sein Atem ist kurz und pfeifend, und seine abgezehrten Hände finden keine Ruhe, als fingerten sie noch immer an den Spielkarten herum, die sein Schwager ihm längst in die Tasche gesteckt hat. Mrs. Boyd schläft bereits, ihr Gesicht unter den Löckchen ist entspannt, ich habe nie ein weichlicheres, seelenloseres Gesicht gesehen. Ich sage das mit einem Anflug von Neid. Denn obwohl ich die Hand der Stewardess in der meinen halte und am Einschlafen bin, muß ich in letzter Minute einige beunruhigende Gedanken zurückdrängen.
Als ich bei Tagesanbruch aufwache, sind sie wieder da. Durch das Kabinenfenster ist nur ein Meer weißlicher flockiger Wolken zu sehen, und man hat den Eindruck, sich darin genußvoll unter einer strahlenden Sonne sielen zu können, als ob die Luft die Dichte des Wassers hätte und die »Außentemperatur«, wie die Stewardessen sagen, nicht »minus 50 Grad Celsius« betrüge.
In meinem Kopf klickt es, und mir fällt wieder der seltsame Bericht der Murzec ein: der Flugplatz, der keiner ist, der See,der nicht zugefroren ist, der Boden, der mit Staub bedeckt ist statt mit Schnee oder Eis, wie man bei der sibirischen Kälte, die wir erlitten, erwartet hätte. Allerdings saßen wir ohne unser Wissen im heftigsten Durchzug, weil der Inder die Luke im Heck geöffnet hatte; niemand konnte sich jedoch erklären, im Namen welcher Logik er diesen Ausgang dem anderen vorgezogen hatte.
Die Stewardess sitzt nicht mehr neben mir. Sie muß in die Pantry gegangen sein, um das Frühstück vorzubereiten. Ich schwanke, ob ich ihr helfen soll, aber da ich mich nicht mit meinem nächtlichen Bartwuchs vor ihr sehen lassen möchte. ziehe ich es egoistischerweise vor, mich mit meinem Reisenecessaire zur Toilette zu begeben.
Ich meine der erste zu sein. Aber nein, in der Touristenklasse begegne ich Caramans, der frisiert, rasiert, mit untadelig offizieller und korrekter Miene von dort kommt. Zu meiner großen Überraschung begnügt er sich nicht damit, mich zu grüßen: obwohl er
Weitere Kostenlose Bücher