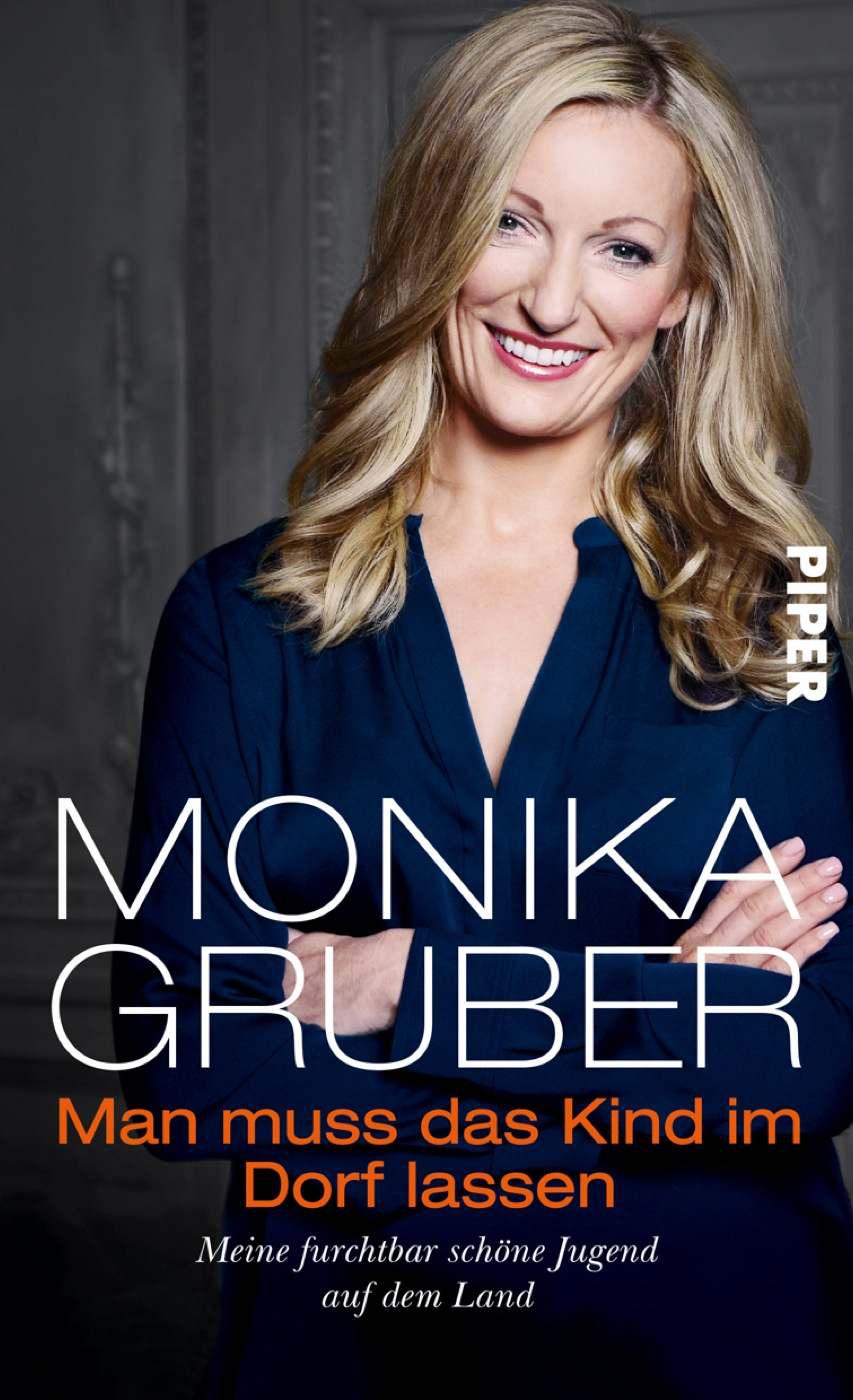![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
einer dicken knusprigen Panade mit dem wunderbaren Kartoffelsalat von der Mama, den sie nur mit Essigessenz und Öl, Zwiebeln, Salz, Pfeffer und etwas Dill angemacht hat. Keine Mayonnaise, lauwarme Brühe, Gurken oder irgendeinen modischen Krampf. Oder es gab einfach nur gekochte Kartoffeln, also Pellkartoffeln, mit Brathering aus der Dose. Ab und zu, wenn der Papa einen guten Tag hatte, kaufte er eine Dose Tomatenfisch beim Bäcker dazu, den wir Kinder besonders gern mochten, viel lieber als den schrumpeligen Brathering, der immer ein bissl so aussah, als hätten Archäologen ihn als Teil eines Römerfundes ausgegraben und einfach mit etwas Essigsud aufgegossen, damit er nicht so staubtrocken schmeckt. Dagegen war der Tomatenfisch in dieser sämig roten Soße, von der man auch noch den letzten Rest mit einer Semmel aus der Dose tunken konnte, ein Gedicht und wurde deshalb am Tisch ausgerauft. Vom Tomatenfisch gab es immer zu wenig, fand ich. Wahrscheinlich habe ich deshalb bis heute immer ein paar Dosen davon im Kühlschrank, auch wenn nichts anderes mehr drin liegt: mittelscharfer Senf, zwei Flaschen Prosecco und ein paar Dosen Tomatenfisch, das wären die Gaben, die ich für überraschende Halloween-Besucher auch im Juni immer vorrätig hätte. Ansonsten esse ich ihn mit Freuden selber. Gern auch ohne Semmel. Im Stehen in der Küche, nachts um zwei. Dazu ein kühles Pils. Herrlich. Ich finde, man kann nie genug Tomatenfisch daheim haben.
Nach dem Mittagessen legte sich der Opa immer zu einem kleinen Mittagsschläfchen hin, um gegen vierzehn Uhr wieder aufzustehen und draußen nach dem Rechten zu schauen: nach Ponys, Vogelhäuschen, zu flickenden Fahrradschläuchen, oder einfach, um im Holzschuppen das zusammengesammelte »Glump« nach etwas zu durchsuchen, was man per Zeitungsannonce eventuell noch verkaufen konnte. Eine anstrengende Arbeit, von der man sich natürlich gegen sechzehn Uhr mit einer kräftigen Brotzeit erholen musste.
Der Opa schnitt sich dazu immer auf einem eckigen Brotzeitbrettl aus Resopal, auf dem die Wurstmotive nur noch schwer erkennbar waren, dick mit Butter bestrichene Brotkeile zurecht, die – je nach Jahreszeit – mit Wurst, Käse oder Radi (Rettich) und Tomaten belegt waren. Weiches, flaumiges Weißbrot mochte er am liebsten, besonders wenn es ganz frisch war. Das lag wahrscheinlich daran, dass das Brot in seiner Jugend nur einmal pro Woche selbst gebacken wurde, sodass es dadurch meistens eher hart und teilweise sogar schimmelig war. Der grüne Flaum wurde damals nicht etwa durch einen großzügigen Schnitt gesundheitsbewusst entfernt, sondern lediglich mit einem scharfen Messer vorsichtig abgeschabt, damit möglichst wenig Brot verloren ging.
Brot in der Form, wie wir es immer bekamen, war eigentlich für meinen Opa die Ausnahme. Wahrscheinlich war er deshalb so leicht zu bekochen: Er aß nämlich einfach alles – außer Fleisch an einem Freitag. Als ich zwischen dreizehn und vierzehn Jahren anfing, in der Küche herumzuexperimentieren, war Opa immer eines der Opfer, dem meine Versuche vorgesetzt wurden, und er verschlang einfach alles: riesige Mengen von Penne all’arrabbiata (molto piccante, also sehr scharf!), Gyros mit viel Zaziki, Suppenteller voll von würzigem Chili con Carne, Türme von Knoblauchnudeln, Pizza mit viel zu dickem Boden, Tiramisù mit selbst gebackenem Biskuit, eine üppige, mit viel Rum getränkte Malakoff-Torte und Bananenmuffins mit einer dicken Schokoglasur. Der Opa war für alles zu begeistern, und wenn man ihn fragte, ob es ihm schmeckte, sagte er immer zwischen zwei Bissen mampfend dasselbe: »Ja, guad is’… wirklich.«
Und da er besonders scharf auf Kuchen und Torten war und diese schon mit Begeisterung zu seinem morgendlichen Milchkaffee verschlang, mussten meine Mama und ich immer aufpassen, dass er das Zeug nicht in die Finger bekam, bevor es überhaupt ganz fertiggestellt war. Einmal hatte meine Mama für einen Geburtstag von ihrer Tante Rosl eine Prinzregententorte gebacken. Eine Heidenarbeit, wenn man alle acht oder neun Biskuitböden einzeln bäckt, die Buttercreme selber anrührt und auch noch darauf achtet, dass die Form sich nicht nach oben wie der Schiefe Turm von Pisa in eine Richtung biegt, sondern ein homogener Creme-Biskuit-Turm in seiner ganzen fettglänzenden Pracht entstehen soll. Allerdings wollte sie mit dem Außenputz, sprich dem Schokoladenguss – ich möchte fast sagen: dem heikelsten Teil des Prinzregenten-Prozesses –
Weitere Kostenlose Bücher