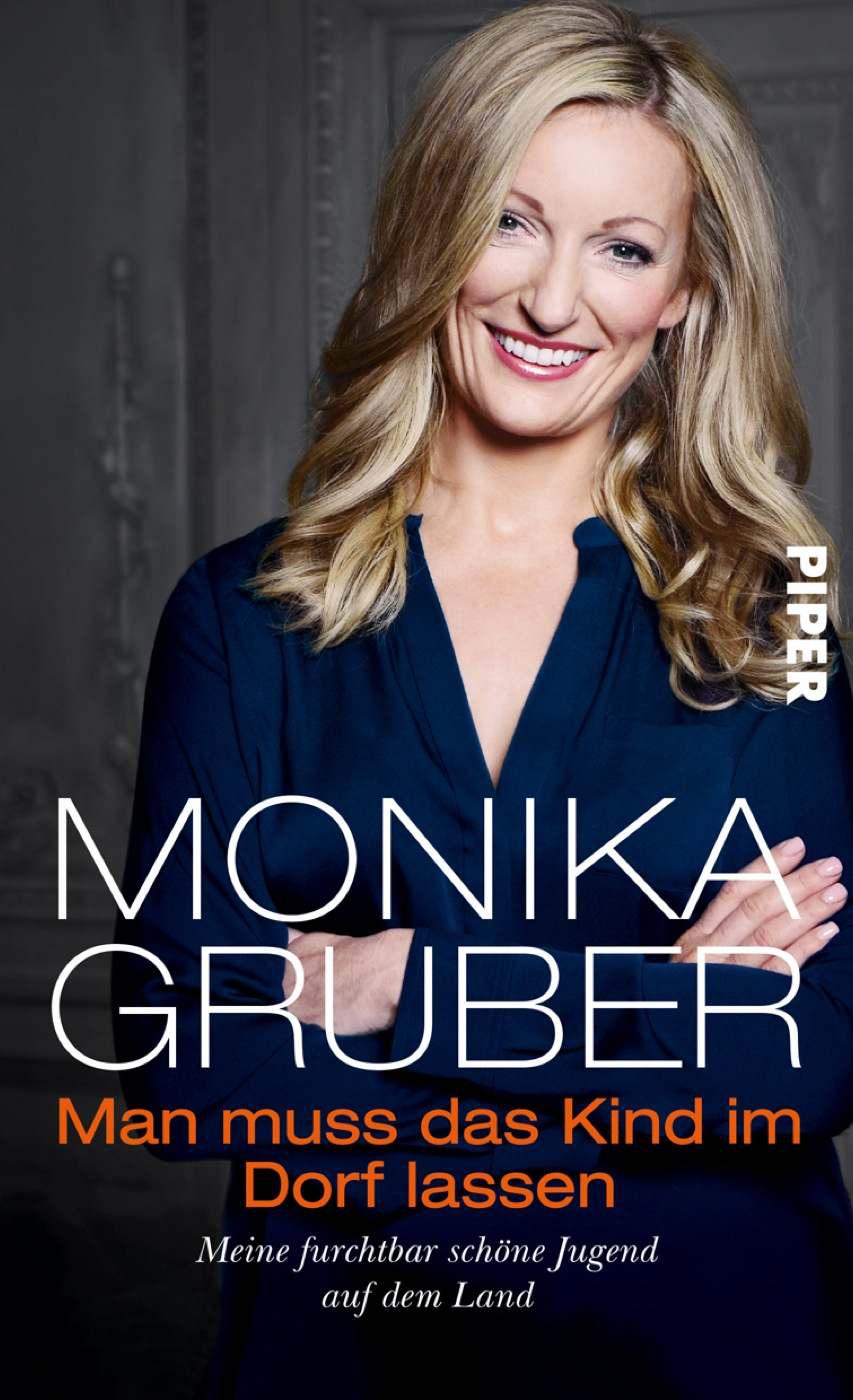![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
dann noch von einer Frau. Das war dem Opa zu viel. Mit großen Schritten und erhobenem Stecken ging er auf die Oma zu, während wir Kinder mit offenem Mund dastanden, und er sagte mit – für seine Verhältnisse – relativ lauter Stimme zu ihr: »Kannst jetzt du ned staad sein, wenn ich eh lauf!« Und dabei schwang er den Stecken bedrohlich vor ihrer Nase. So grantig hatten wir den Opa noch nie gesehen. Und mit Gegenständen hatte er auch noch nie vor irgendjemandes Nase herumgefuchtelt. Das war auch der Oma klar. Die war daraufhin ganz still: »I mein ja bloß.«
Und zusammen mit dem Opa trieben wir dann die Ponys wieder zurück auf die hintere Weide.
Dem Opa aber war sein aufbrausendes Verhalten so unangenehm und peinlich, dass er sofort am nächsten Morgen – es war Samstag – mit dem Radl zum Beichten fuhr, um für sein sündhaftes Verhalten um göttliche Vergebung zu bitten.
Pünktlich zum Mittagessen um halb zwölf war er wieder da, und als meine Mutter zu ihm sagte: »Aber, Miche, da hätt’s ja ned gleich zum Beichten fahren müssen«, da meinte er immer noch leicht fassungslos: »Ja, ich weiß aa ned, was gestern mit mir los war.«
Aus der Stadt mitgebracht hat uns der Opa nie etwas, weil er der Meinung war, dass wir eh schon so viel bekamen. Wir nahmen ihm das nie übel, weil wir ja wussten: »Da Opa sammelt alles für die armen Leid.« Und »arme Leid«, die sahen alle ganz anders aus als wir und lebten in Afrika. Das wussten wir schon. Denn der Opa zeigte uns immer die Bilder, die vorn auf dem Prospekt von Misereor drauf waren oder auch auf der katholischen Kirchenzeitung: Bilder von kleinen schwarzen Kindern, die mit den Fingern klebrigen Reis aus dreckigen Schüsseln aßen oder einen einfach nur mit großen braunen Kulleraugen anstarrten. Es war völlig klar, wer die Kinderschokolade, die Brausestäbchen und die Gummibärchen nötiger hatte. An Geburtstagen bekamen wir dafür immer zwei Mark von ihm und am Namenstag fünf, denn der Namenstag zählte natürlich für ihn mehr. An Weihnachten bekamen wir auch meistens nichts, weil wir ja da »eh schon so viel kriegen«.
Wenn meine Mutter Brot oder Butter benötigte, dann schaffte sie es dem Opa an, und er brachte ihr meistens auch genau das mit, um was sie ihn gebeten hatte, wobei er nie Markenprodukte kaufte, sondern immer das billigste Discounterprodukt. Das holte er dann aus seinem grau-schwarzen Stoffrucksack mit den Lederklappen, legte den Beleg dazu und sagte dann zu meiner Mama: »Fünf Mark dreiazwanzge hab i zahlt, Leni.« Denn obwohl er für Kost, Logis und die Erledigung seiner Wäsche nichts bezahlte – auf diese Idee wären meine Eltern nie gekommen –, wollte er seine Auslagen auf Heller und Pfennig wiederhaben. Und meine Mutter hat es ihm immer gegeben, weil: »So is er halt, der Miche.«
Und wenn das Essen nicht pünktlich um halb zwölf auf dem Tisch stand, dann wurde er unruhig, und wenn es vielleicht sogar schon auf Viertel vor zwölf zuging, dann sagte er meist laut in Richtung meiner Mutter, die an den dampfenden Töpfen auf dem Herd herumhantierte: »Ja, ich mein allweil, ich such mir dann selber was zum Essen.«
Mein Vater beschwichtigte ihn dann immer: »Geh, es gibt ja glei was.«
Mittags wurde bei uns immer ein Tischgebet gesprochen, sonst hätte der Opa nicht anfangen können. Geredet wurde während des Essens nie viel, weil jeder damit beschäftigt war, so schnell wie möglich alles in sich hineinzuschaufeln in der Hoffnung, noch den Knödel zu bekommen, der als Letztes einsam und allein in der Schüssel lag.
Sonntags gab es immer eine Nachspeise, auf die ich mich zusammen mit dem Opa immer besonders freute. Am liebsten mochte ich die Bayerisch Creme von meiner Mama, die meist mithilfe von eingelegten Kirschen, Kirschwasser und Schokostreuseln zu einer »Schwarzwälder Creme« aufgemotzt wurde. Ab und an passierte es, dass sie sich bei den Portionen ein wenig verschätzte und statt sieben Schüsselchen plötzlich acht fertig hatte. Da ich meiner Mama beim Tischdecken und Anrichten helfen musste, war ich eine der Ersten, die das merkte. Dann schnappte ich mir schnell einen Löffel, schaufelte die überzählige Nachspeise in mich rein, um dann nach dem Essen in aller Gelassenheit mein zweites Dessert genießen zu können.
Freitags gab es meistens eine Mehlspeise, denn am Tag des Herrn durfte man kein Fleisch essen. Nicht einmal eine Wurscht zur Brotzeit. Ab und zu gab es auch Fisch: entweder ein Goldbarschfilet in
Weitere Kostenlose Bücher