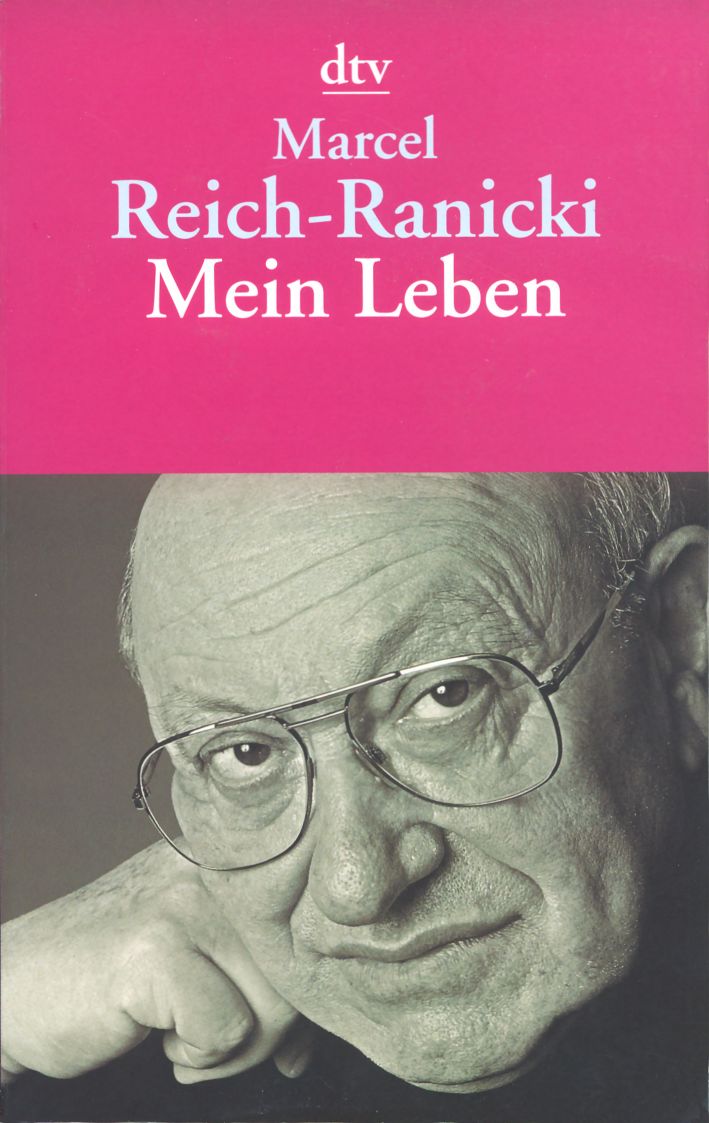![Mein Leben]()
Mein Leben
zusammenbrechen, stand ein solcher Schrank – und ich hatte oft Gelegenheit, von dieser Fundgrube Gebrauch zu machen. Denn der Onkel hatte einen hübschen Sohn, der damals etwa fünf Jahre alt war, und ich wurde häufig als Babysitter benötigt. Es waren wunderbare Abende: Ich konnte mich mit zahllosen Büchern vergnügen und wurde auch noch großzügig entlohnt. Ich bekam für jeden Abend eine Mark und zuweilen, wenn der Onkel kein Kleingeld hatte, sogar zwei Mark. Das Kind wiederum, das ich zu betreuen hatte, ist während dieser Abende kein einziges Mal aufgewacht. Ein vorbildliches Knäblein also – und jetzt einer der berühmtesten Maler Englands: Frank Auerbach.
Das Geld brauchte ich dringend, aber vorwiegend für Theaterkarten, nicht etwa für Bücher. Wer auswanderte, konnte nur wenig mitnehmen, die Bibliotheken blieben meist zurück. Und wenn man schon ins Exil Bücher mitnahm, dann nicht Romane oder Gedichtbände, sondern Fachliteratur und, vor allem, Wörterbücher. Was bleiben mußte, wurde verschenkt.
Von einem Freund dieses Onkels, einem Chemiker in Berlin-Schmargendorf, der seine Emigration vorbereitete, durfte ich mir Bücher holen. Er riet mir, einen kleinen Koffer oder einen Rucksack mitzubringen. Ich kam aber zu ihm mit einem großen Koffer. Ich hätte, log ich, keinen kleineren gefunden. Der liebenswürdige, wenn auch allem Anschein nach deprimierte Chemiker öffnete seinen Bücherschrank und sagte gleichgültig oder gar resigniert: »Nehmen Sie mit, was Sie wollen.«
Was ich zu sehen bekam, machte mich sprachlos, die Augen gingen mir über. Noch heute weiß ich, was mir sofort auffiel: die »Gesammelten Werke« von Hauptmann und Schnitzler und auch von Jens Peter Jacobsen, den Rilke so schön und nachdrücklich empfohlen hatte. Ich nahm rasch, was sich in meinem Koffer unterbringen ließ, ohne mir Gedanken zu machen, wie schwer er sein würde. Ich konnte ihn kaum tragen, brachte ihn aber schließlich doch zur nächsten Straßenbahn-Haltestelle.
Die Last hat mein Glück nicht gemindert, auch nicht die elegische Warnung des freundlichen Chemikers. Denn als ich ihm herzlich dankte, winkte er ab und belehrte mich: »Sie haben mir für gar nichts zu danken. Diese Bücher schenke ich Ihnen nicht. Sie sind Ihnen in Wirklichkeit nur geliehen – wie diese Jahre. Auch Sie, mein junger Freund, wird man von hier vertreiben. Und diese vielen Bücher? Sie werden sie genauso zurücklassen, wie ich es jetzt tue.« Recht hat er gehabt: Ich habe noch manche Bücher aus manchen Schränken zusammengerafft, aber als ich etwa zwei Jahre später aus Deutschland deportiert wurde, durfte ich nur ein einziges mitnehmen.
Gelegentlich habe ich in den Lesesälen der städtischen Büchereien von den dort ausliegenden Zeitschriften profitiert und mitunter Aufsätze gefunden, die mich interessierten und die ebenfalls nicht ohne Einfluß auf meine Lektüre blieben. So fiel mir 1936 in den »Nationalsozialistischen Monatsheften« der markige Titel einer literarkritischen Abhandlung auf: »Schluß mit Heinrich Heine!« Ich las den Aufsatz mit wachsender Aufmerksamkeit, mehr noch: mit Genugtuung.
Der Autor, ein Philologe, hatte sich vor allem zweier Gedichte angenommen, die zu Heines populärsten gehören: der »Loreley« und der »Grenadiere«. Beide, behauptete er, seien beispielhaft für Heines ungenügende und seichte Kenntnis der deutschen Sprache und sein »noch nicht abgestreiftes Jiddisch«. Davon zeuge, schrieb damals ein anderer Germanist, schon der erste Vers der »Loreley«: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.« Ein deutscher Mann hätte geschrieben: »Ich weiß nicht, was es bedeuten soll.« Mir war es schon recht, daß die Nazis, die Heine beschimpften, Unsinn verbreiteten, der sich schwerlich überbieten ließ.
Die Lektüre dieser »Nationalsozialistischen Monatshefte« hat aus mir einen passionierten Heine-Leser gemacht.
Was ich freilich nirgends finden konnte, war die Literatur der Emigranten. Natürlich wollten wir lesen, was die vertriebenen und geflohenen Schriftsteller jetzt schrieben, doch konnten wir nichts bekommen. Wer ins Ausland fuhr und wiederkam, wagte es nicht, Bücher oder Zeitschriften mitzubringen, und an postalische Übersendung war nicht zu denken. Allerdings gab es zwei bedeutsame und denkwürdige Ausnahmen, zwei aufregende Abende, die ich nie vergessen werde. An beiden wurden Dokumente der deutschen Literatur im Exil vorgelesen: Es waren zwei (sehr unterschiedliche) Briefe.
Meine
Weitere Kostenlose Bücher