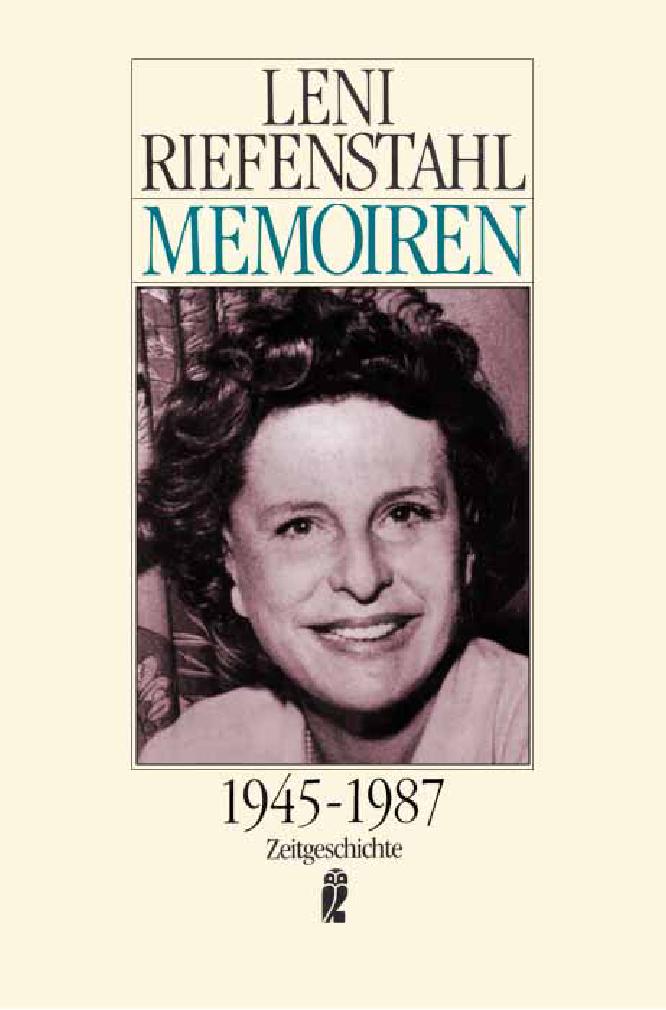![Memoiren 1945 - 1987]()
Memoiren 1945 - 1987
zeigten mir noch unbekannte Eingeborenen-Stämme, für die ich ein besonderes Interesse hatte. Die Filme und Fotos, ob gut oder schlecht, faszinierten mich. Der Gedanke, daß ich das alles in absehbarer Zeit auch erleben würde, machte mich ganz verrückt. Nun wollte Herr von Krupp auch meine Fotos und Dias sehen, die ich während der «Schwarzen Fracht» in Ostafrika gemacht hatte: Tieraufnahmen und Bilder von den Masai. Sie gefielen ihm so gut, daß er mich bat, das Material seinem Freund, dem Prinzen Bernhard von den Niederlanden, zu senden, der ebenfalls daran interessiert war. Nun erst wagte ich, ihn um Unterstützung für den Film zu bitten — jedoch hatte ich kein Glück. Herr von Krupps Sekretär teilte mir mit, die Firma hätte in letzter Zeit zu viele Projekte unterstützt, so daß weitere Mittel für einen solchen Zweck bedauerlicherweise nicht verfügbar seien. Ich habe von Herrn von Krupp nichts mehr gehört. Hätte ich diese Bitte doch nicht ausgesprochen.
Nicht anders erging es mir mit dem deutschen Großindustriellen Harald Quandt, dem ehemaligen Stiefsohn von Goebbels. Ich kannte ihn persönlich nicht, aber aus besonderem Anlaß konnte ich mit ihm in Verbindung kommen. Die Fliegerin Hanna Reitsch hatte mir
1945 während unserer Gefangenschaft einen Brief gezeigt, den Dr. Goebbels und seine Frau ihr übergeben hatten, bevor sie in der Reichskanzlei Selbstmord verübten. Sie hatten sie gebeten, diesen Brief Harald Quandt, der sich damals in Italien als junger Offizier
in amerikanischer Gefangenschaft befand, zuzuleiten. Harald Quandt war der Sohn aus Magda Goebbels’ erster Ehe.
Wie von Alfried Krupp erhielt ich zuerst eine positive Antwort. Harald Quandt lud mich ein, ihn und seine Gattin in Homburg zu besuchen. Ich flog sofort nach Frankfurt, wo ich von einer großen Limousine abgeholt und nach Homburg gefahren wurde. Dort empfing mich Frau Inge Quandt, eine junge, sehr hübsche Frau von fast zerbrechlich wirkender Zartheit. Einfach, aber elegant gekleidet, war sie eine aparte Erscheinung. Sie entschuldigte ihren Mann, der erst zum Abendessen kommen würde. Da sie Berlinerin war wie ich, ergab sich bald ein guter Kontakt. Bevor sie mir Tee anbot, zeigte sie mir ihr Haus. Imponierend war die ungewöhnliche Größe des Wohnraums, vor allem aber die Aussicht. Durch die nach Süden gelegene große Fensterwand sah man bis zum weit entfernten Horizont kein Haus, kein einziges Gebäude, nur riesengroße Wiesenflächen, die von einem Waldrand umsäumt waren.
Auch der Fußbodenbelag, tiefschwarz und so weich und langhaarig wie das Fell eines großen Bären, ist mir noch in Erinnerung geblieben. Am meisten aber erstaunte mich, daß um den Tisch, an dem der Tee serviert wurde, plötzlich aus dem Fußboden geräuschlos Wände hochkamen und bis zur Decke wuchsen, so daß wir uns in einem kleinen intimen Salon befanden.
«Mein Mann», sagte Frau Quandt lächelnd, «liebt solche technischen Spielereien. Davon gibt es noch mehrere in diesem Haus.»
Nach Sonnenuntergang verdunkelte sie das große Zimmer. Durch einen Knopfdruck legten sich in wenigen Sekunden kostbare schwere Stoffvorhänge vor die riesige, gebogene Fensterfront, während der Raum langsam durch verborgene Lichtquellen in weichen Farben erstrahlte. Für mich war das alles ganz und gar unwirklich, aber ich hatte das Gefühl, die junge Frau, die hier wie in einem Zauberreich lebte, war nicht glücklich. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als ihr Mann etwas verspätet nach Hause kam. Sie ließ mich mit ihm allein, um, wie sie sagte, die Abendmahlzeit vorzubereiten. Nachdem wir einen Drink genommen hatten, zeigte mir Quandt seine technischen «Spielereien», wie seine Frau sie genannt hatte: Elektronische Anlagen, Filmvorführgeräte und weiteren technischen Komfort, an den ich mich nicht mehr so genau erinnern kann. Herr Quandt wirkte abgespannt wie ein überarbeiteter Manager. Über die Vergangenheit oder Politik fiel kein einziges Wort, auch nicht, als ich auf den Brief von Hanna Reitsch zu sprechen kam. Er sagte
nur, er habe ihn bekommen.
Beim Abendessen, das im Gegensatz zu den luxuriösen Räumen in einem fast schmucklosen Zimmer, im Souterrain, eingenommen wurde, lernte ich auch die Kinder kennen. Ich glaube, es waren vier oder fünf meist blonde Mädchen. Das Essen war spartanisch einfach, so auch die Konversation. Die Atmosphäre war ziemlich steif, ich war froh, als die Mahlzeit vorüber war. Den Abend
Weitere Kostenlose Bücher