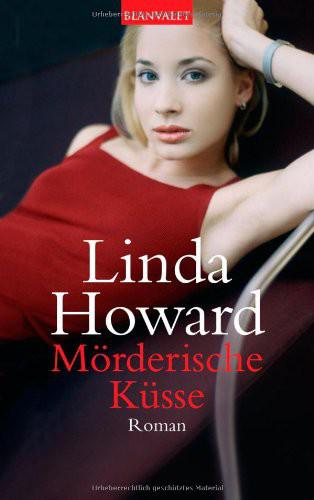![Moerderische Kuesse]()
Moerderische Kuesse
kein Weichei. »Ich riskiere damit mein Leben und vor allem das meiner Angehörigen. Rodrigo Nervi verzeiht keinen Verrat.«
»Sie arbeiten für ihn?«
»Nein. Nicht im eigentlichen Sinn.«
»Was soll das heißen? Entweder er bezahlt sie, oder er bezahlt Sie nicht. Was denn nun?«
»Solange ich ihm gewisse Informationen zukommen lasse, Monsieur, lässt er meine Familie am Leben. Ja, er bezahlt mich auch; das Geld macht mich noch abhängiger, nicht wahr?«
Seine sonst so ruhige Stimme klang bitter. »Es garantiert, dass ich nicht rede.«
»Ich verstehe.« Swain hörte auf, den harten Burschen zu mimen – oder schaltete zumindest einen Gang herunter –, obwohl er wahrscheinlich gar nicht zu mimen brauchte, so leicht, wie ihm das Spielen fiel. »Eines verwirrt mich. Woher wusste Nervi überhaupt, dass ich hier bin, wieso hat er nach mir gefragt? Ich nehme an, deshalb fiel mein Name und daher haben Sie auch meine Nummer.«
»Er wollte die wahre Identität einer Ihrer Agentinnen erfahren.
Ich
glaube,
sie
wurde
von
einem
Gesichtserkennungsprogramm identifiziert. Der Maulwurf beschaffte ihre Akte und ersah daraus, dass Sie losgeschickt wurden, um das Problem zu beseitigen.«
»Woher wusste er, dass sie unsere Agentin ist?«
»Das wusste er nicht. Er wählte verschiedene Ansätze, sie zu identifizieren.«
So also war Rodrigo zu dem Foto von Lily gekommen, das sie ohne ihre Verkleidung zeigte. Rodrigo wusste also, wie Lily aussah und wie sie hieß. »Weiß Nervi auch, wie ich heiße?«, erkundigte sich Swain.
»Das kann ich nicht sagen. Ich bin seine Verbindungsstelle zur CIA, und ich habe Ihren Namen nicht weitergegeben. Er wollte sich mit Ihnen in Verbindung setzen.«
»Warum, um Gottes willen?«
»Um Ihnen einen Deal vorzuschlagen, nehme ich an. Eine beträchtliche Summe im Austausch gegen alles, was Sie über den Aufenthaltsort der gesuchten Frau in Erfahrung bringen.«
»Wie kommt er darauf, dass ich so einem Deal zustimmen würde?«
»Sie sind doch zu kaufen, oder?«
»Nein«, beschied ihn Swain knapp.
»Sie sind kein Agent?«
»Nein.« Mehr brauchte er nicht zu sagen. Wenn ihn die CIA geschickt hatte und er kein Agent war, dann musste er zur anderen Kategorie gehören: Führungsoffizier. Bestimmt war der
Mann
schlau
genug,
um
sich
das
selbst
zusammenzureimen.
»Aha.« Er hörte, wie der andere scharf einatmete. »Dann war meine Entscheidung richtig.«
»Und zwar?«
»Ihre Telefonnummer nicht weiterzugeben.«
»Obwohl Sie dadurch Ihre Familie in Gefahr bringen?«
»Ich habe mich abgesichert. Es gibt noch einen Nervi, den jüngeren Bruder, Damone, der … ein bisschen aus der Art geschlagen ist. Er ist intelligent und vernünftig. Als ich ihm erklärte, welche Konsequenzen es haben kann, jemanden zu kontaktieren, der für die CIA arbeitet, und als ich ihm darlegte, dass dieser Mensch davon ausgehen muss, dass seine Telefonnummer nur weitergegeben werden konnte, weil jemand in der CIA sie herausgegeben hat – außerdem könnte der Betreffende seinem Land wirklich treu sein –, da erkannte Damone, wie Recht ich mit meinen Bedenken hatte. Er sagte, er würde Rodrigo berichten, dass der Mann von der CIA – also Sie, natürlich – hier ein Handy gemietet und sich noch nicht wieder in der Zentrale gemeldet hat, weshalb es im Augenblick noch keine Nummer gäbe.«
Das klang ganz vernünftig, auch wenn die Erklärung etwas verworren gewesen war. Wahrscheinlich wusste Rodrigo nicht, dass Führungsoffiziere bei einem Einsatz im Ausland entweder ein abhörsicheres internationales Handy oder ein satellitengestütztes Handy verwendeten.
Und schon fügte sich das nächste Steinchen ins Bild. Wenn die Informationen aus der CIA über diesen Mann an Rodrigo Nervi weitergeleitet wurden, musste er einen Posten haben, der es ihm erlaubte, sensible Daten anzufordern – und hatte demnach eine Menge zu verlieren, falls irgendjemand davon erfuhr. »Für wen arbeiten Sie?«, fragte er. »Interpol?«
Er hörte ein kurzes Stocken und dachte triumphierend: Bingo! Ein Schuss ins Schwarze. Es sah so aus, als hätte Salvatore seine schmutzigen Finger in viele Töpfe gesteckt, in denen er nichts verloren hatte.
»Sie wollen es Nervi also heimzahlen«, folgerte er, »ohne dabei Ihre Familie zu gefährden. Sie können sich nicht offen weigern, seine Bitten zu erfüllen, richtig?«
»Ich habe zwei Kinder, Monsieur. Vielleicht verstehen Sie nicht –«
»Ich habe auch zwei Kinder, ich verstehe also sehr
Weitere Kostenlose Bücher