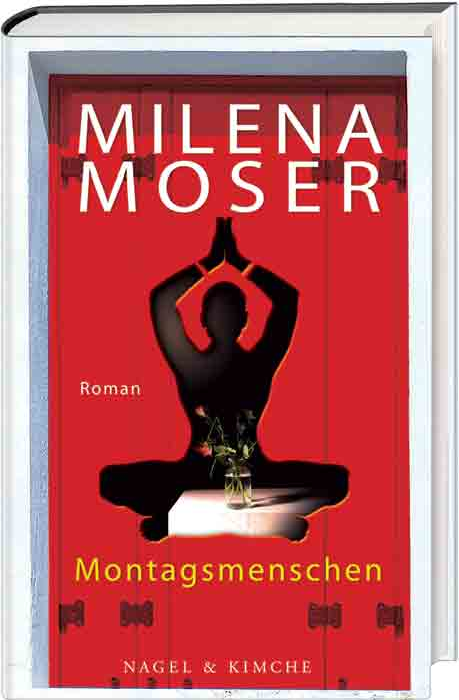![Montagsmenschen - Moser, M: Montagsmenschen]()
Montagsmenschen - Moser, M: Montagsmenschen
Steinerschule in der nächsten Stadt. Doch er wusste, dass die Jungen sich auf dem Fußballplatz trafen. Oft hatte er ihnen von ferne zugeschaut, und er hatte trainiert. Er wusste, dass er gut spielen musste, um einen guten Einstand zu haben. Ein Fußball kostete vierzehn Franken neunzig. Die Kinder in der Wohngemeinschaft bekamen kein Taschengeld. Wenn sie etwas brauchten, brachten sie ihr Anliegen an der Hausversammlung vor, dann wurde darüber abgestimmt und das Geld aus der Gemeinschaftskasse genommen. Ted wusste, dass er mit einem Fußballwunsch gar nicht erst ankommen musste. Die Mädchen, die dagegenstimmen würden, waren in der Mehrzahl, und die Mütter hielten Fußball ohnehin für eine Vorbereitung auf den Krieg: Gegnerische Mannschaften bekämpften sich, es wurde geschossen, gesiegt oder verloren. Also musste er die vierzehn Franken neunzig aus der Gemeinschaftskasse nehmen, eines Morgens ganz früh, bevor die anderen wach waren. Er kaufte den Ball und versteckte ihn unter seinem Bett. Mit diesem Ball unterm Arm, lässig im Ellbogen, das hatte er geübt, ging er zum Sportplatz im Dorf. Die Jungen verstummten, als sie ihn kommen sahen, unterbrachen ihr Spiel, rückten zusammen, es waren fünf oder sechs, manche größer als er, manche kleiner.
«Langhaariger!», rief einer. «Du Hippie! Hau ab!»
Damit hatte Ted gerechnet. Lässig ging er auf sie zu, als würde er sie gar nicht sehen. Wenige Schritte von der Gruppe entfernt, ließ er den Ball fallen, dann nahm er Anlauf, kickte den Ball über ihre Köpfe hinweg und ins Tor am anderen Ende des Fußballfelds.
Mehr brauchte es nicht. Nun war er einer von ihnen. Er hatte die Welt der Mädchen verlassen.
«Bewegt langsam wieder eure Finger, eure Zehen», sagte Nevada. Ted streckte sich. Neben ihm seufzte Marie wie ein Kind im Schlaf. Nevada wartete, bis sich alle Schüler aufgesetzt hatten, dann hob sie ihre Hände an die Stirn und lächelte.
«Danke fürs Mitmachen!»
Ted stand auf und rollte seine Matte zusammen. In der Männergarderobe war er allein. Er zog sich um, fuhr sich mit den Händen durchs Haar und ging nach unten. Auf halber Treppe holte ihn Marie ein. «Gehst du auch noch mit in die Bar?»
Er nickte. Sie hakte sich bei ihm unter. Im Eingang atmeten sie beide tief ein. Sie hielten sich aneinander fest, als sie auf die Gruppe zugingen, die sich um Gion gebildet hatte. Und in deren Mittelpunkt Lilly saß, die Hand auf Gions Schenkel, den Kopf zurückgelegt, den Mund weit offen. Sie lachte laut. Maries Hand drückte seinen Arm, dann entzog sie sich ihm.
Kurz nach diesem Nachmittag hatte seine Mutter Balthasar kennengelernt, den Mann, den sie später heiraten würde. Sie waren in eine andere Stadt gezogen, in eine ganz normale Wohnung. Sie würden eine ganz normale Familie sein. Wenigstens ein paar Jahre lang. Ted hatte sich als Erstes einen Haarschnitt gewünscht. Balthasar hatte ihn mit einem Rasiergerät geschoren, und seine Mutter hatte geweint.
Poppy
Freundschaft annehmen? Poppy starrte auf den Bildschirm. Sie spielte Solitaire, beantwortete E-Mails, chattete, hörte Musik und frischte ihr Facebook-Profil auf. Und da war es: Dr. Wolf Bolliger möchte mit dir befreundet sein.
Befreundet? Wolf war ihre erste Liebe gewesen. Nein, nicht die erste, die zweite. Aber die erste, die zählte. Wie lange war das her? Fünfundzwanzig Jahre. Die Hälfte ihres Lebens. Wenn man nur im Voraus wüsste, was man vergessen würde. Und was bleibt. Dann würde man vieles anders machen.
Von ihrer ersten Liebe wusste sie nur noch, dass er sie verlassen hatte. Nachdem sie ein halbes Jahr getrauert hatte, hatten ihre Freundinnen genug gehört. «Du musst den Teufel mit dem Beelzebub austreiben», hatte eine von ihnen geraten und Poppy zu einem Konzert mitgenommen. Als die Band Pause machte, schaute sie sich im Lokal um, ortete einen einsamen Mann an der Theke und schubste Poppy geradewegs in seine Arme. Sie schüttete ihr Bier über sein T-Shirt und versprach, ihm ein neues zu kaufen, ein schöneres, später gingen sie zusammen nach Hause. Es funktionierte sofort, Poppy vergaß den anderen, den ersten. Den Teufel. Aber sie liebte ihn nicht. Den Beelzebub. Erst, als es zu spät war.
Wolf war kein Beelzebub und auch kein Wolf. Er war ein Hase. Er war freundlich, hörte ihr zu, er sah sie durch seine dicken Brillengläser hindurch an und sagte: «Erzähl.» Oder: «Und dann? Was ist dann passiert?» Und sie erzählte, bis sie sich selber langweilte. Weil
Weitere Kostenlose Bücher