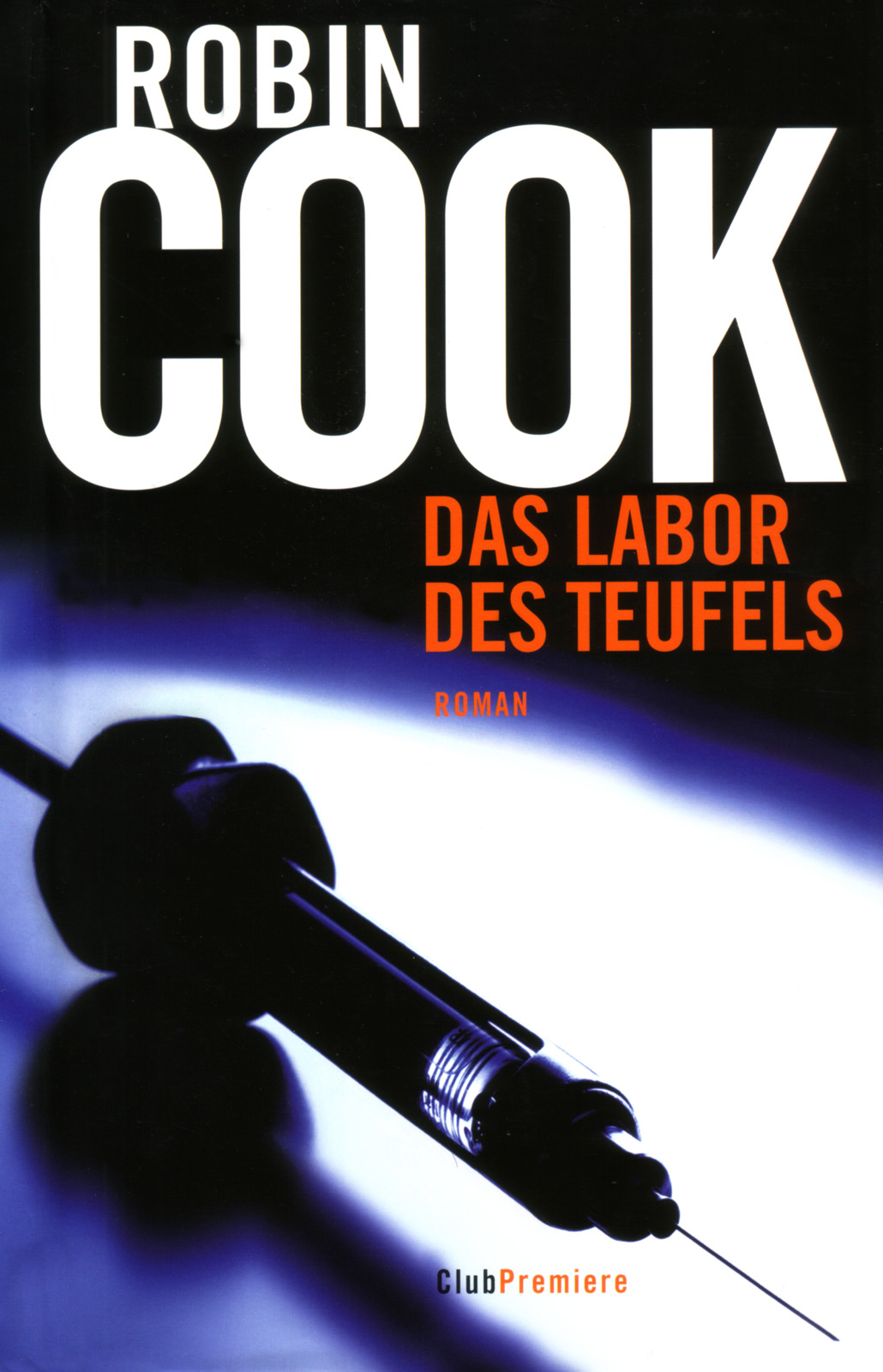![Montgomery & Stapleton 05 - Das Labor des Teufels]()
Montgomery & Stapleton 05 - Das Labor des Teufels
Stephen Lewis, ein muskulöser Afroamerikaner, war bis zur Hüfte nackt, seine rechte Schulter mit einem Verband umwickelt, und in seinem linken Arm steckte eine Kanüle. Er hatte das Kopfteil aufgerichtet und saß im Bett, über dem Fußende hing ein Fernseher an der Decke. Jazz konnte nicht sehen, was für ein Programm gerade lief, aber sie hörte, dass es eine Sportsendung sein musste.
Stephen blickte vom Fernseher zu Jazz. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
»Ich wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist«, antwortete Jazz, was ja auch stimmte. Sie war zufrieden. Das würde wirklich ein Kinderspiel werden.
»Mir würd’s schon besser gehen, wenn die Knicks mit ihrem Spiel mal endlich in die Pötte kämen«, erwiderte Stephen.
Jazz nickte, winkte ihm zu und ging zurück zum Fahrstuhl.
Sie hatte ihren Erkundungsgang erledigt, fuhr hinunter ins Erdgeschoss und ging in die Kantine. Ja, sie war wirklich zufrieden.
Die erste Hälfte der Nachtschicht verlief wie erwartet. Jazz hatte elf Patienten zugewiesen bekommen, eine mehr als ihre Kolleginnen, aber sie beschwerte sich nicht. Der Ausgleich war, dass sie mit der besten Schwesternhelferin zusammenarbeitete. Leider war sie nicht für Rowena Sobczyk zuständig und hatte so viel zu tun, dass sie Mr Bobs Auftrag erst jetzt in ihrer Essenspause würde erledigen können.
Jazz fuhr mit den beiden anderen Krankenschwestern und zwei Schwesternhelferinnen, die zur selben Zeit Pause machten, in die Kantine hinunter, setzte sich aber so schnell wie möglich von ihnen ab. Sie wollte sich nicht in deren Geschwätz verwickeln lassen, um dann nicht mehr von ihnen loszukommen. Stattdessen schlang sie im Stehen ein Sandwich und ein großes Glas Milch hinunter. Sie hatte nur dreißig Minuten Zeit, und es gab viel zu tun.
Während der Arbeit hatte sie ein paar Spritzen zu den Kaliumchloridampullen in ihre Kitteltaschen gesteckt. Von der Kantine aus ging sie zu den Toiletten. Mit einem raschen Blick unter die Kabinentüren vergewisserte sie sich, dass sie alleine war. Dann schloss sie sich in eine Kabine ein, nahm die Ampullen heraus, brach die Kappen ab und zog sorgfältig die Spritzen auf. Nachdem sie die Abdeckungen wieder über die Nadeln geschoben hatte, ließ sie die Spritzen zurück in ihre Kitteltaschen gleiten. Draußen am Waschbecken wickelte sie die leeren Ampullen dick in Papierhandtücher ein.
Bisher war niemand hereingekommen. Sie legte die Papierrolle auf den Boden, zertrat die Ampullen mit dem Absatz ihrer Schuhe und warf das Papier in den Mülleimer.
Jazz blickte sich im Spiegel an, strich mit den Fingern durch ihr strähniges Haar, zog den Kittel glatt und rückte das Stethoskop um ihren Hals zurecht. Zufrieden und für ihren Auftrag gerüstet, ging sie zur Tür. Das war ja richtig einfach gewesen. Sie hatte schon ihren Spaß daran, dass sie gleich zwei Fälle auf einmal erledigen musste. Alles lief wie am Schnürchen.
Mit dem Hauptfahrstuhl fuhr sie in den dritten Stock hinauf. Sie wollte nicht wieder durch die Eingangshalle des Goldblatt-Flügels gehen, um bei den Sicherheitsleuten keinen Verdacht zu erregen. Der gesamte dritte Stock wurde von der Kinderabteilung eingenommen, und während sie den Flur entlang zum Goldblatt-Flügel ging, brachte der Gedanke an die kranken Kinder hinter den Türen die Erinnerung an den kleinen Janos zurück. Jazz war diejenige gewesen, die ihn an jenem verhängnisvollen Morgen tot aufgefunden hatte. Das arme Kind hatte mit dem Gesicht nach unten zwischen den Falten des Lakens gelegen und war steif wie ein Brett und leicht blau angelaufen gewesen. Jazz, selbst noch ein Kind, hatte Panik bekommen und war verzweifelt ins Schlafzimmer ihrer Eltern gerannt, um sie zu wecken. Die jedoch waren betrunken gewesen und mit nichts wach zu bekommen. Schließlich hatte Jazz selbst die 911 angerufen und dem Rettungsdienst die Tür geöffnet.
Eine schwere Brandschutztür trennte den Goldblatt-Flügel vom eigentlichen Krankenhaus. Diese schien selten benutzt zu werden, denn Jazz musste sich mit einem Fuß am Türpfosten abstützen, um sie mit Wucht aufzustoßen. An die Einrichtung des Goldblatt-Flügels war sie ja nun schon gewöhnt, doch was ihr besonders auffiel, war das Licht. Statt der üblichen Neonröhren entlang der Decke hingen Leuchter und Strahler an den Wänden, die jetzt heruntergedimmt waren.
Sie drückte noch einmal mit der Schulter gegen die Tür, um sich zu vergewissern, dass sie sich für ihren Rückzug auch
Weitere Kostenlose Bücher