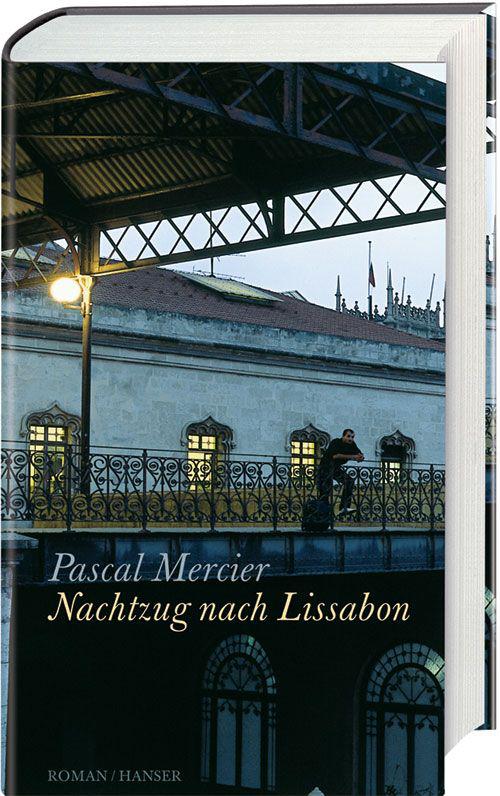![Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)]()
Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)
Geräten.
Die Untersuchung dauerte mehr als eine Stunde. Die Geräte sahen anders aus als bei Doxiades, und Senhora Eça studierte seinen Augenhintergrund mit der Ausführlichkeit von jemandem, der sich mit einer ganz neuen Landschaft vertraut macht. Was Gregorius jedoch am meisten beeindruckte, war, daß sie die Tests zur Sehschärfe dreimal wiederholte. Zwischendurch gab es Pausen, in denen sie ihn auf und ab gehen ließ und in ein Gespräch über seinen Beruf verwickelte.
»Wie gut man sieht, hängt von so vielen Dingen ab«, sagte sie lächelnd, als sie sein Erstaunen bemerkte.
Am Ende stand eine Dioptrienzahl da, die von der gewohnten deutlich abwich, und die Werte für die beiden Augen lagen weiter auseinander als sonst. Senhora Eça sah ihm die Verwirrung an.
»Probieren wir es einfach«, sagte sie und berührte ihn am Arm.
Gregorius schwankte zwischen Abwehr und Zutrauen. Das Zutrauen siegte. Die Ärztin gab ihm die Visitenkarte eines Optikers, und dann rief sie dort an. Mit ihrer portugiesischen Stimme kehrte der Zauber zurück, den er empfunden hatte, als die rätselhafte Frau von der Kirchenfeldbrücke das Wort português ausgesprochen hatte. Plötzlich ergab es einen Sinn, daß er in dieser Stadt war, einen Sinn freilich, den man nicht benennen konnte, im Gegenteil, es gehörte zu diesem Sinn, daß man ihm nicht Gewalt antun durfte, indem man versuchte, ihn in Worte zu fassen.
»Zwei Tage«, sagte die Ärztin, als sie aufgelegt hatte, »noch schneller, sagt César, geht es beim besten Willen nicht.«
Jetzt holte Gregorius das Bändchen mit den Aufzeichnungen von Amadeu de Prado aus der Jackentasche, zeigte ihr den sonderbaren Verlagsnamen und erzählte von der vergeblichen Suche im Telefonbuch. Ja, sagte sie zerstreut, es klinge nach einem Selbstverlag.
»Und die roten Zedern – es würde mich nicht wundern, wenn sie eine Metapher für etwas wären.«
Das hatte sich Gregorius auch schon gesagt: eine Metapher oder ein Code für etwas Geheimes – Blutiges oder Schönes –, verborgen unter dem bunten, welken Laub einer Lebensgeschichte.
Die Ärztin ging in einen anderen Raum und kehrte mit einem Adreßbuch zurück. Sie schlug es auf und fuhr mit dem Finger eine Seite entlang.
»Hier. Júlio Simões«, sagte sie, »ein Freund meines verstorbenen Mannes, ein Antiquar, der uns über Bücher immer mehr zu wissen schien als jeder andere Sterbliche, es war geradezu unheimlich.«
Sie schrieb die Adresse auf und erklärte Gregorius, wo das war.
»Grüßen Sie ihn von mir. Und kommen Sie mit der neuen Brille vorbei, ich möchte wissen, ob ich es richtig gemacht habe.«
Als Gregorius sich auf dem Treppenabsatz umdrehte, stand sie immer noch unter der Tür, die eine Hand am Rahmen. Silveira hatte mit ihr telefoniert. Dann wußte sie vielleicht auch, daß er davongelaufen war. Er hätte ihr gern davon erzählt, und auf dem Gang durchs Treppenhaus waren seine Schritte zögerlich wie bei jemandem, der einen Ort ungern verläßt.
Der Himmel hatte sich mit einem feinen, weißen Schleier überzogen, der den Glanz des Sonnenlichts verwischte. Das Geschäft des Optikers lag in der Nähe der Fähre über den Tejo. César Santaréms mürrisches Gesicht hellte sich auf, als Gregorius ihm sagte, von wem er kam. Er blickte auf das Rezept, wog die Brille, die ihm Gregorius reichte, in der Hand und sagte dann in gebrochenem Französisch, diese Gläser könne man auch aus leichterem Material machen und in ein leichteres Gestell einsetzen.
Das war in kurzer Zeit das zweite Mal, daß jemand das Urteil von Konstantin Doxiades in Zweifel zog, und es kam Gregorius vor, als nähme man ihm sein bisheriges Leben aus der Hand, das, solange er sich erinnern konnte, ein Leben mit einer schweren Brille auf der Nase gewesen war. Unsicher probierte er Gestell nach Gestell und ließ sich schließlich von Santaréms Assistentin, die nur Portugiesisch konnte und wie ein Wasserfall redete, zu einem schmalen, rötlichen Gestell verführen, das ihm für sein breites, eckiges Gesicht viel zu modisch und chic vorkam. Auf dem Weg hinüber zum Bairro Alto, wo das Antiquariat von Júlio Simões lag, sagte er sich immer wieder, daß er die neue Brille als Ersatzbrille behandeln konnte und gar nicht zu tragen brauchte, und als er schließlich vor dem Antiquariat stand, hatte er sein inneres Gleichgewicht wiedergefunden.
Senhor Simões war ein drahtiger Mann mit scharfer Nase und dunklen Augen, aus denen quecksilbrige Intelligenz sprach.
Weitere Kostenlose Bücher