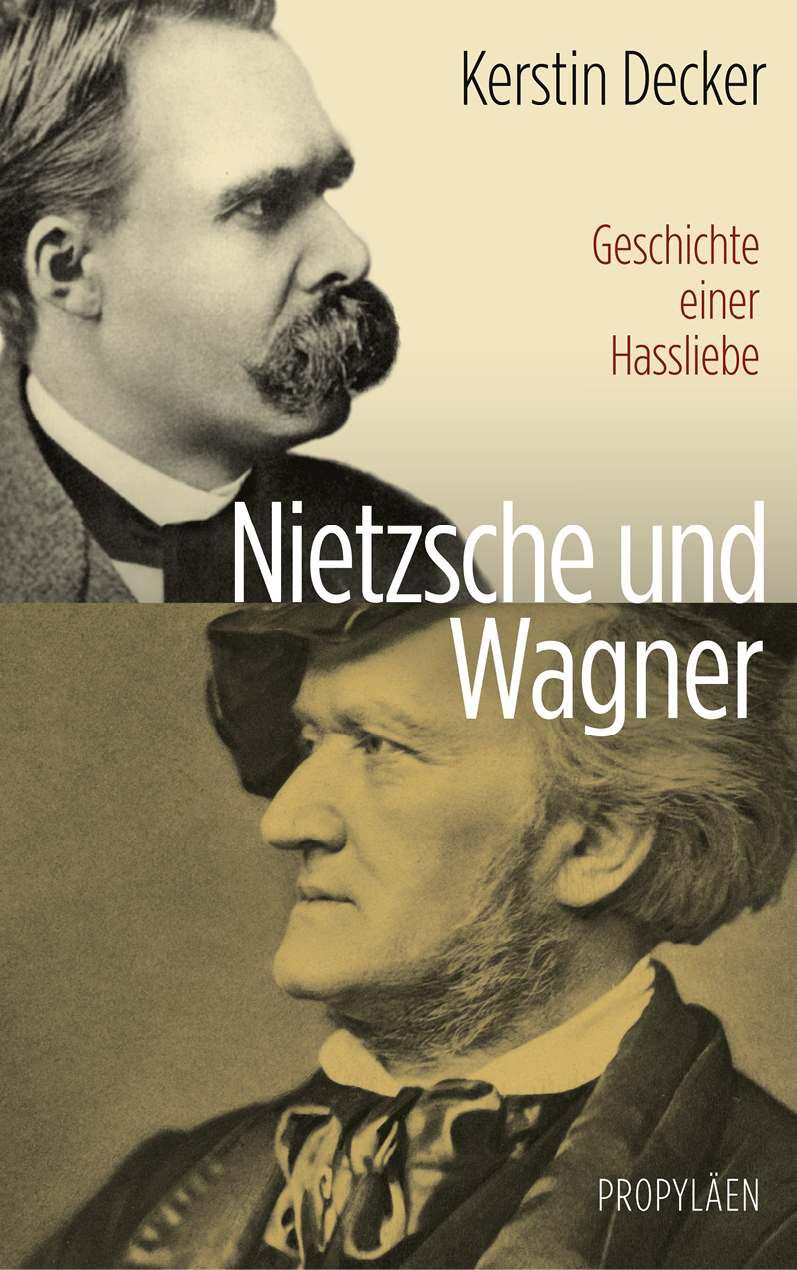![Nietzsche und Wagner: Geschichte einer Hassliebe]()
Nietzsche und Wagner: Geschichte einer Hassliebe
»Die Entstehung des tragischen Gedankens«, es ist das gereifte Sommer-Manuskript aus dem Maderanertal, unter neuem Titel.
Und dann, am 25. Dezember – es ist ein Sonntag – morgens um 7.30 Uhr erklingt eine nie gehörte Musik im Treppenhaus. Zu Wagners Geburtstag hatte Cosima es in einen Garten verwandelt, aber jetzt ist keine Zeit für Blumen, wozu auch? Sie sind alle in dieser Musik. Die Beschenkte: »Wie ich aufwachte, vernahm mein Ohr einen Klang, immer voller schwoll er an, nicht mehr im Traum durfte ich mich wähnen …« Ihr ist, als ob das Haus, ihr »ganzes Dasein, in Töne sich erhob und zum Himmel stieg«. Als sie verklingen, tritt ihr Mann mit den fünf Kindern ein und überreicht ihr die Partitur des »Symphonischen Geburtstagsgrußes«: »… in Tränen war ich, aber auch das ganze Haus; auf der Treppe hatte R. sein Orchester gestellt und so unser Tribschen auf ewig geweiht!« 216 Nietzsche, der doch alles mitgehört hat, mit dem sie fast jede Stunde gemeinsam verbringt, erhält gleichwohl eine Karte von ihr, Hauspost:
»Es war ein schöner Morgentraum
daran zu deuten wage ich kaum
Tribschner Idyll
25 ten December 1870
Die selige Morgentraumdeutweise«
Jakob Sulzer, ein guter Freund Wagners, kommt am Mittag, und sie spielen das Stück noch einmal, das man einmal unter dem Namen »Siegfried-Idyll« kennen wird.
Den Tribschenern wird so tristanisch, so zerfließend zumute, gleichwohl trägt Richard Wagner aus der »Geburt des tragischen Gedankens« vor. Cosima registriert mit Freude, »daß R.’s Ideen auf diesem Gebiet ausgedehnt werden können« 217 . Der Professor würde sich gegen das Verb »ausdehnen« zur Kennzeichnung seiner Tätigkeit gewiss verwahren.
Um sich vom »tragischen Gedanken« wieder zu erholen, lesen sie zusammen E. T. A . Hoffmanns Märchen vom »Goldnen Topf«, entstanden in Wagners Geburtsjahr und vielleicht wie kein anderes von Hoffmanns Märchen »den kleinen Grenzverkehr zwischen zeitlosem Märchenland und deutscher Wirklichkeit« (Gerhard Seidel) kultivierend. Zu dritt tauchen sie tief hinein in die Welt, die der junge Richard Wagner liebte, wo alles Wirkliche so gespenstisch wirkt, das Phantastische, Gespenstische aber umso wirklicher. Es ist niemand im Zimmer, der die Hoffmann ’ sche Welt nicht für die einzig wahre und heimatliche hält. Um das weltverlorene Tribschener Haus herum liegt tiefer Schnee.
Bald spüren alle, dass Hoffmann ihre eigene Geschichte aufgeschrieben hat: Der Student Anselmus, zur Melancholie wie zum Außerordentlichen tief begabt, »ein kurioses Subjekt« nach Ansicht der Bürger, nicht unbedingt weltgeeignet, mitunter schon an ihrem kleinsten Widerstand scheiternd, rennt versehentlich den Apfelkorb eines alten Weibleins um, »am Himmelfahrtstage, nachmittags um drei Uhr« zu Dresden am Schwarzen Tor. Vielleicht ruhen bereits jetzt lange Blicke auf dem Gast des Hauses, nicht ohne Teilnahme, denn sie wissen, wie es weitergeht. Die geschädigte Alte kreischt dem Studenten hinterher: »Ja renne – renne nur, Satanskind – ins Kristall bald dein Fall – ins Kristall!« 218 Die düstere Prophezeiung trifft ein: Der außerordentliche Student findet sich nur allzu bald »in einer wohlverstopften Kristallflasche auf einem Repositorium im Bibliothekszimmer des Archivarius Lindhorst« wieder.
Wenn der Professor Anselmus ist, muss es sich beim Archivarius zweifelsohne um Richard Wagner handeln. Schon Hoffmanns Archivarius trägt am liebsten Schlafröcke und besitzt davon mindestens ebenso viele, wie man es Richard Wagner nachsagt.
Was aber bringt den Studenten in die Flasche des Archivarius?
E. T. A . Hoffmann hat die Begegnung des Studenten Nietzsche mit dem Geisterfürsten – denn nur seiner bürgerlichen Existenz nach ist Lindhorst Archivarius – aufmerksam protokolliert: »… der Student Anselmus geriet seit jenem Abende, als er den Archivarius Lindhorst gesehen, in ein träumerisches Hinbrüten, das ihn für jede äußere Berührung des gewöhnlichen Lebens unempfindlich machte. Er fühlte, wie ein unbekanntes Etwas in seinem Innersten sich regte und ihm jenen wonnevollen Schmerz verursachte, der eben die Sehnsucht ist, welche dem Menschen ein anderes Sein verheißt.« Näherhin ist es die Verlockung der goldgelben Schlange Serpentina, Tochter des Archivarius, »der ewigen Geliebten« seiner Seele. Und in der Tat, letztlich wird Friedrich Nietzsche keine andere Frau lieben als sie: die Schlange, die Weisheit, geistursprünglich vor
Weitere Kostenlose Bücher