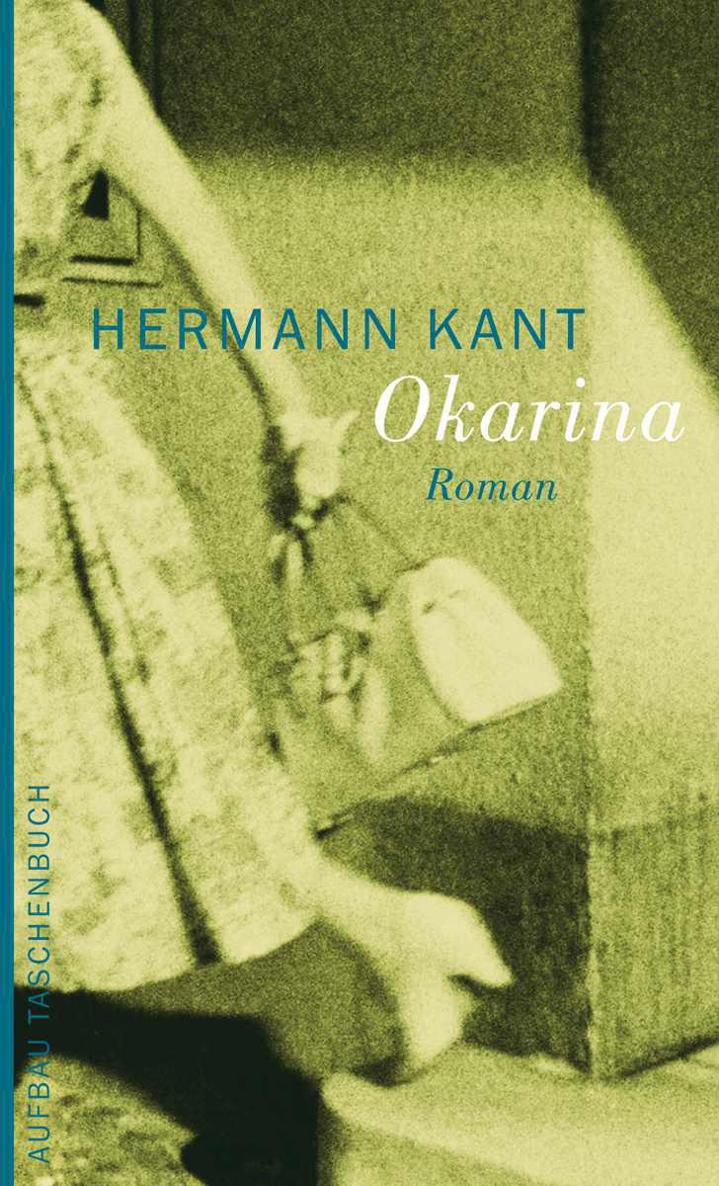![Okarina: Roman (German Edition)]()
Okarina: Roman (German Edition)
junge Hemingway an mir gemessen wurde, rede ich schon nicht. Crane ist der mit The Red Badge of Courage , und Hemingway ist der mit The Sun Also Rises. Und dieser Mailer ist einer von den jungen Löwen, die meinen, es ergibt schon einen Kriegsroman, wenn man Naturalismus mit Freud und Jung verrührt und es The Naked and the Dead betitelt. Da sollte sich verstehen, daß ich, wenn ich mich zu dieser Maßstablosigkeit äußere, kein Auge für eine Kutsche habe. Oder für einen Kutscher, der nicht da ist.«
»Ich vergesse keineswegs, daß man dich mit Tolstoi und diesen Hemingway mit dir verglichen hat. Aber im Unterschied zu dir, der du zu bescheiden bist, halte ich es für selbstverständlich. Unverständlich ist mir dagegen, wieso hier ein Wagen mit einem Pferd steht, und ein Kutscher ist weit und breit nicht zu sehen.«
»Bitte, meine Liebe«, sagte der Mann, »unterlasse die Feigenwächterei. Was schiert dich ein Pferd im Geschirr, zu dem du keinen Kutscher siehst? Vielleicht liegt der Mann im Wagen und schläft seinen Rausch aus. Vielleicht tritt er gleich hervor und ordnet seine Kleider. Vielleicht steht er hier auf dürrer Heide und fragt sich, was wir bei seinem Wagen wollen, wie du dich fragst, wieso er nicht bei ihm ist. Weißt du, was ich denke?«
»Du wirst es mir sagen.«
»Manchmal denke ich, es ist meine Schuld: Du siehst zu viel, weil ich zu wenig sehe. Ich will nun einmal jetzt keine Kutsche sehen, ich will nun einmal jetzt mit dir über die Heide gehen und die einfachen Dinge des Lebens bereden. Einfach die einfachen Dinge des einfachen Lebens. Weißt du, was ich denke?«
»Lasse es mich hören!«
»Ich denke, alles ist eine Frage der Zeit. Wäre ich vor Tolstoi dagewesen, hätte man ihn mit mir verglichen. Nun vergleicht man mich mit ihm. Das ist ja auch schon was, würde Fontane sagen.«
»Es ist das mindeste«, sagte die Frau und zog ihren Mann an Josef Stalinskis Kutsche und an dem kutscherlosen Pferd und an uns vorbei hinaus in die Schönholzer Heide.
Wir aber, die Hauptwachtmeisterin oder Hauptkommissarin Fedia, meine Hauptgeneralin Fedia und ich, wir lagen auf den gepolsterten Wagendielen, verschlossen einander den Mund, weil wir hätten schreien mögen, hielten eins das andere fest, auf daß wir nicht vor Entzücken um uns schlügen, und kamen, als Fedia von mir Abschied nahm, überein, von der Begegnung mit der Unsterblichkeit zu schweigen. Was leichter gesagt war als getan. Weil es mich lockte, von diesem Einblick in Übergröße zu berichten. Woran mich nur die kaum vermeidbareFrage hinderte, was wir in diesem Gefährt zu suchen hatten. Trotz starker Neigung habe ich außer Flair und Slickmann niemandem von dem Austausch erzählt, der Fedia und mich hinter Späherscharten zu lustvollen Zeugen hatte. Gegenseitig beglückten wir uns vielmals mit der Geschichte. Ich konnte sie gar nicht oft genug aufführen. Wahrscheinlich hoffte ich, beim vielfachen Da-capo herauszufinden, was an meiner Freundin Fedia so besonders sei.
Manchmal scheint mir, sie war ähnlich mir ein wenig verrückt. Welcher vernünftige Mensch steigt, mich zu treffen, am hellichten Tag in Berlin-Ost in eine beräderte Kiste, die einen aufsehenerregenden Firmennamen trägt und in deren Deichsel ein aufsichtsloses Pferdchen wartet und den Eindruck macht, es stehe Schmiere? Welcher Mensch, der General werden will, legt sich neben mich auf den Bauch, hört weltumspannendem Literatenruhm und einer siebenhundertjährigen Ehe zu und lacht sich lautlos aus aller Fassung? Welcher vernünftige Mensch führt sich so und bei anderen Gelegenheiten so ähnlich auf und entfernt sich grußlos aus meinem Leben und läßt mich mit dessen beschissenem Rest allein?
Es ist verrückt, auf diese Weise an Fedia zu denken, und zunehmend häufig scheint mir, daß nicht nur sie, sondern wir alle, Fedia, Ronald, Flair, die Bicks, die Moellers und allen voran ich, hochgradig Verrückte waren. Je öfter ich unser Betragen an den derzeit gültigen Bescheiden messe, desto deutlicher sehe ich, wir müssen verrückt gewesen sein. Je länger ich höre und lese, wie wir hätten sein sollen und was wir hätten tun sollen, als wir den Soscholismus versuchten – beziehungsweise, soweit es die Moellers und die Bicks betraf, ihm zu entgehen suchten –, um so sicherer bin ich: Es war in hohem Maße verrückt, was wir machten. Anstatt damals zu tun, was uns heute für damals vorgeschlagen wird, taten wir, als wüßten wir, was wir taten. Wo wir schon deshalb
Weitere Kostenlose Bücher