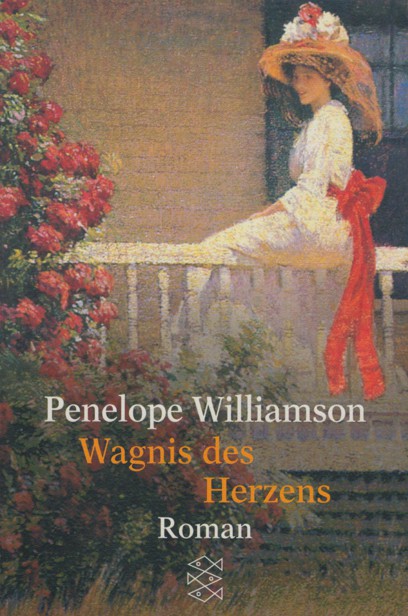![Penelope Williamson]()
Penelope Williamson
sie dem Iren zu verdanken hatte. Es war nur eine
kleine Wunde gewesen und hatte sich bereits geschlossen. Aber Emma glaubte oft,
ihr Herz dort zu spüren. Es klopfte schnell und stark, als sei es direkt unter
der Haut und bemühe sich darum, ungestüm hervorzubrechen.
Emma schloß
die Hand und öffnete sie wieder. Sie rieb die Handfläche auf dem Knie. Als sie
den Kopf hob, stellte sie fest, daß die Carter-Schwestern sie beobachteten, und
saß still. Wenigstens war sie allein im Kirchenstuhl der Tremaynes. Niemand von
der Familie konnte ihre mangelnde Selbstbeherrschung zur Kenntnis nehmen.
Maddie hatte seit dem Unfall nicht mehr das Haus verlassen. Sie besuchte nicht
einmal mehr den Gottesdienst, obwohl sie früher gerne im Kirchenchor gesungen
hatte. Aber ihr Erscheinen im Rollstuhl hätte die Aufmerksamkeit auf sie und
die unglückselige Behinderung gelenkt. Das hätte dem Ansehen der Familie
geschadet. Zumindest behauptete das ihre Mutter. Deshalb fügte sich Maddie.
Ihre
Mutter war an diesem Morgen wegen stechender Kopfschmerzen im Bett geblieben.
In der vergangenen Woche waren die Wilbur Nortons von einer Kreuzfahrt nach
Florida zurückgekommen. Sie erzählten alle möglichen Geschichten von William
Tremayne und seiner neuen Geliebten und von den Festen auf seiner Yacht. In der
Vergangenheit hatte Mama die Seitensprünge ihres Mannes stets ignoriert. Aber
diese letzte Demütigung war zuviel für sie gewesen.
»Es ist
deine Pflicht, auf unserer Kirchenbank zu sitzen«, hatte sie Emma am
Morgen eingeschärft. Sie lag umflossen von einem wahren Wasserfall aus
Brüsseler Spitze im Bett und lehnte sich stöhnend, umgeben von Flaschen mit
Laudanum und Riechsalz, in die seidenen Kissen. »Denke an das Ansehen unserer
Familie und an das, was sich für eine Tremayne gehört. Emma, mein Kind, du bist
unsere einzige Hoffnung.«
Du bist
unsere einzige Hoffnung ...
Nach der Hochzeit würde Emma
neben Geoffrey und seiner Großmutter auf der Bank der Alcotts sitzen.
Wenigstens,
dachte sie, hat man auf der gegenüberliegenden Seite einen anderen Blick, auch
wenn sich an den Predigten nichts ändert. Sie sah ihren Zukünftigen an. Er
hielt den schmalen Kopf aufrecht. Im Kerzenschein, der sich in den bunten
Glasfenstern der Kirche brach, wirkten sein Gesicht und seine Haare wie
vergoldet. Er hielt den Blick fest auf den Pfarrer gerichtet, als lese er ihm
die Worte von den Lippen ab, aber möglicherweise beobachtete er nur interessiert
die auf und ab schwingenden wulstigen Wangen des Pfarrers. Geoffrey trug eine
Gardenie im Knopfloch seines grauen Gehrocks. Nun ja, er achtete stets auf
tadelloses Aussehen. Vermutlich hatte er in seinem Leben noch niemals Anstoß
erregt.
Emma schritt durch das glänzende Eschenholzportal von St.
Michael und atmete tief die feuchte graue Luft ein. Sie knöpfte den langen
Seehundpelzmantel bis zum Kinn zu und schob die Hände in den kleinen runden
Hermelinmuff. Nach dem schon warmen Wetter zu Anfang des Frühlings war es noch
einmal unangenehm kalt geworden. Das, so dachte sie mit einem leichten Seufzer,
bot den Damen der Gesellschaft wieder einmal genügend Stoff zur Unterhaltung.
Geoffrey trat zu ihr. Er setzte den Zylinder auf und zog seine grauen
Handschuhe glatt. Er lächelte sie strahlend an und entblößte dabei seine
vorstehenden Zähne.
Früher
hatte sie sein Lächeln gemocht ... daran hatte sich eigentlich nichts geändert.
Ja, sie fand sein Lächeln sympathisch, aber trotzdem empfand sie diesmal bei
seinem Anblick einen leichten Widerwillen, ohne einen Grund dafür nennen zu
können.
»Das war heute eine großartige
Predigt! Findest du nicht auch, mein Schatz?« sagte er. »Wirklich erhebend.«
»Es war
dieselbe Predigt wie jedes Jahr«, erwiderte Emma und hielt unwillkürlich die
Luft an, denn sie glaubte, plötzlich unter einem nassen Handtuch zu ersticken.
Sie würde Geoffrey heiraten, und deshalb hätte sie gerne von ihm gewußt,
worüber er im Gottesdienst wirklich nachgedacht hatte. Doch die
gesellschaftlichen Konventionen gestatteten ihnen nicht, über so persönliche
Dinge wie Gedanken und Gefühle zu sprechen.
»Geoffrey«,
fragte sie statt dessen, »glaubst du an Gott?«
Er nahm
ihren Arm. Dabei umspannten seine Finger ihren Ellbogen etwas zu fest. Dann
führte er sie zum Seiteneingang, damit keine ungebetene Ohren ihr Gespräch
mithören konnten.
»Wie kannst du an einem
Sonntagmorgen mitten auf den Stufen von St. Michael eine solche Frage stellen?«
»Du
Weitere Kostenlose Bücher