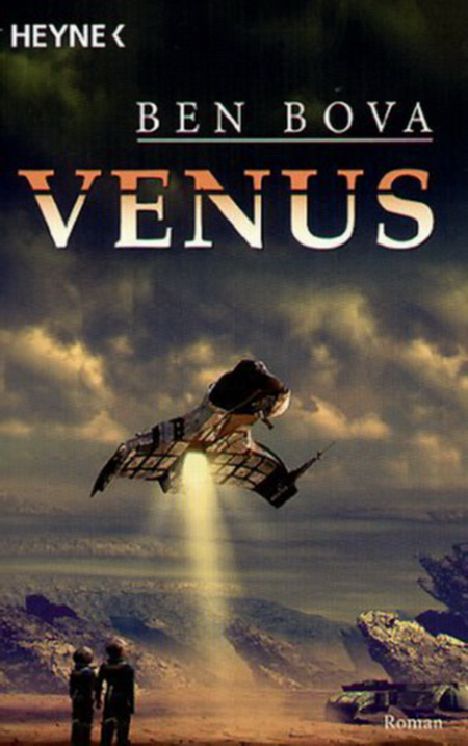![Planeten 03 - Venus]()
Planeten 03 - Venus
hinüber und sah, dass auch er versonnen den Monitor betrachtete. Seine Gedanken galten Duchamp, wie ich vermutete.
Hatte er sie wirklich geliebt? Vermochte er überhaupt jemanden zu lieben?
Er schien zu schaudern und sich förmlich vom Bildschirm loszureißen. »Leider ist das Wrack der Phosphoros nun auf der Nachtseite des Planeten. Die Optik wird uns da nicht viel nutzen.«
»Wir könnten doch abwarten, bis sie wieder auf die Tagseite herüber kommt«, schlug ich vor.
»Sie wollen drei bis vier Monate warten?«, fragte er mich spöttisch. »Mit den Vorräten, die wir noch haben, kommen wir hier unten keine zwei Wochen über die Runden.«
Ich hatte ganz vergessen, dass ein Venustag länger dauert als ein Jahr.
»Nein«, sagte Fuchs mit offensichtlichem Widerwillen, »wir müssen das Wrack Ihres Bruders im Dunklen suchen.«
Großartig, sagte ich mir. Einfach großartig.
Also flogen wir in einem stetigen Sinkflug gemächlich durch die heiße, dichte Atmosphäre und kamen dem glühenden Gestein der Oberfläche immer näher.
Es fiel mir schwer, ein Zeitgefühl zu bewahren. Außer den turnusmäßigen Schichten auf der Brücke und bei Nodon an den Pumpen gab es keine Differenzierung zwischen Tag und Nacht. Die Beleuchtung des Schiffs blieb rund um die Uhr unverändert. Und wenn ich ins Beobachtungszentrum ging und einen Blick nach draußen warf, schien dort auch alles unverändert.
Ich aß, ich schlief, ich arbeitete. Meine Beziehung zu Marguerite, sofern man sie überhaupt als solche bezeichnen wollte, war ruiniert. Außer Nodon, der mich mit Feuereifer alles lehrte, was ich über die Pumpen wissen musste, damit er auf die Brücke versetzt wurde, betrachtete der Rest der Besatzung mich als Paria, oder – noch schlimmer – als einen Spion des Kapitäns.
Der einzige, zu dem ich Kontakt hatte, war Fuchs, und selbst er wirkte zunehmend distanziert und abwesend. Für lange Zeiträume, für ganze Schichten sogar, fehlte er auf der Brücke. Und wenn er dann wieder im Kommandantensessel Platz nahm, er machte einen abwesenden Eindruck und schien in Gedanken ganz woanders zu sein. Oft sah ich ihn diese Pillen kauen, und ich fragte mich allmählich, ob dieser Medikamentenkonsum wirklich gut für ihn war.
Schließlich hielt ich es nicht länger aus. Ich nahm meinen ganzen Mut – oder vielleicht auch die Selbstachtung – zusammen, ging zum Krankenrevier und sprach Marguerite an.
»Ich mache mir Sorgen um den Kapitän«, sagte ich ohne Umschweife.
Sie schaute vom Mikroskop auf, über das sie sich gebeugt hatte. »Ich auch.«
»Ich glaube, er ist von diesen Pillen abhängig, die er nimmt.«
Ihre Augen blitzten, doch sie schüttelte den Kopf und sagte: »Nein, du irrst dich. Das ist es nicht.«
»Woher willst du das denn wissen?«, fragte ich.
»Ich kenne ihn viel besser als du, Van.«
Ich verkniff mir die gehässige Bemerkung, die mir auf der Zunge lag und fragte nur:
»Was dann – ist er krank?«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie und schüttelte erneut den Kopf. »Er will nicht, dass ich ihn untersuche.«
»Irgendetwas stimmt auf jedenfalls nicht«, sagte ich.
»Es liegt vielleicht an den Transfusionen«, sagte Marguerite. »Er kann unmöglich so viel Blut spenden und keine Auswirkungen spüren.«
»Hast du irgendwelche Fortschritte bei der Synthese des Enzyms gemacht?«
»Ich habe alles versucht«, sagte sie. »Aber es war nicht genug.«
»Du kriegst es nicht hin?«
Sie reckte leicht das Kinn. »Es ist nicht zu schaffen. Nicht mit der Ausrüstung, die wir zur Verfügung haben.«
Ich sah Ärger in ihren Augen aufflackern. »Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es deine Schuld ist.«
Ihr Gesichtsausdruck entspannte sich wieder. »Ich weiß. Ich hätte mich nicht gleich aufregen sollen. Ich bin wohl überarbeitet.«
»Ich weiß deine Bemühungen jedenfalls zu schätzen.«
»Es ist nicht nur das ... Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß sogar, wie es zu tun ist – zumindest in der Theorie. Aber uns fehlt die Ausrüstung. Dies ist ein Krankenrevier, kein pharmazeutisches Labor.«
»Wenn wir also nicht rechtzeitig zur Truax zurückkehren ...« Ich brach mitten im Satz ab. Die Weiterungen waren zu deprimierend.
Doch Marguerite führte den Satz für mich zu Ende. »Wenn wir nicht innerhalb von achtundvierzig Stunden zur Truax zurückkehren, wirst du wieder eine Transfusion brauchen.«
»Und wenn ich sie nicht bekomme?«
»Wirst du nach ein paar Tagen sterben.«
Ich nickte. Nun war es
Weitere Kostenlose Bücher