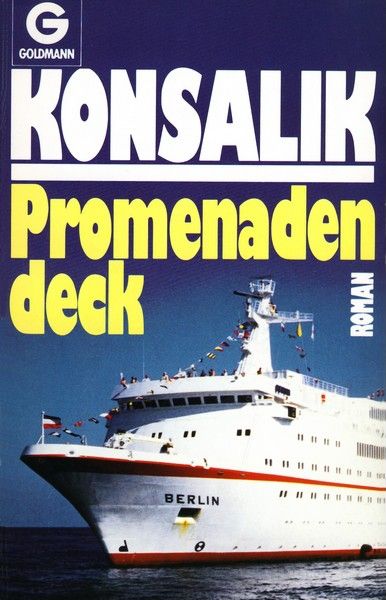![Promenadendeck]()
Promenadendeck
Reling.
»Hopp!«
Neun Schuß und neun Treffer. Über das Schiff legte sich Schweigen. Sylvia, das hatte er beim Laden gesehen, hatte nicht geklatscht. Die Bravorufe von drei Decks hinunter zu ihm waren ihm gleichgültig. Er konnte jetzt nur noch verlieren. Gewinnen war nicht mehr möglich; es gab nur zehn Schuß. Die Partie würde unentschieden enden. Zum endgültigen Ausschießen fehlte die Zeit … das erste Mittagessen begann gleich.
Hans Fehringer rief sein »Hopp!« und hielt den Atem an. Seine Scheibe kam mustergültig von der Schleuder, zischte hoch und leuchtete in der Sonne.
Schuß! – Das Zerplatzen der Tontaube, der Jubel der Passagiere, das Bravo und Applaudieren vereinigten sich zu einem erlösenden Aufschrei.
Mit einem tiefen Aufatmen, wie vorher de Jongh, legte Fehringer sein Gewehr auf den Tisch. Er sah empor zum Sonnendeck. Sylvia benahm sich wie eine Irre, klatschte, hüpfte hoch, immer wieder; wie ein auf der Stelletanzen sah es aus. Und sie schrie mit ihrer hellen Stimme: »Sieg! Sieg! Sieg!«
Knut de Jongh trat nahe an Fehringer heran.
»Revanche?« fragte er hart.
»Jederzeit.«
»Da schreit ein dummes Luder Sieg! Sie haben nicht gesiegt, es ist unentschieden. Alles ist noch unentschieden. Verstehen wir uns?«
»Gründlich, Herr de Jongh.«
»Aber die Entscheidung wird fallen.«
»Das will ich hoffen.«
»Und da unterliegen Sie!«
»Abwarten!« Hans Fehringer winkte nach allen Seiten wie ein glorreicher Matador. Die Passagiere der 1. Tischzeit liefen nun schnell davon, um rechtzeitig an ihre Essensplätze zu kommen. »Wir haben heute beide Glück gehabt, das war es. Aber es ist nicht immer so.«
»Gut, daß Sie das einsehen. Sie sollten diesen Satz in Ihrem Hirn festschrauben.«
De Jongh schob seine Mütze in den Nacken, stieg die Treppe empor zum Sonnendeck und ging auf Sylvia zu. Sie war noch außer Atem vor Begeisterung. »Du solltest jetzt Champagner trinken«, sagte er dunkel. »Wer Sieg schreit, sollte ihn auch feiern.«
Nun lag auch Balboa hinter ihnen, die Hafenstadt am Ende des Panamakanals auf der Pazifikseite, das Tor zur Hauptstadt Panama mit seinem prunkvollen Präsidentenpalast und der mächtigen Kathedrale sowie – nur noch Ruinen – Altpanama, das 1519 von Pedradas Devila gegründet und 1671 von dem Piraten Morgan zerstört wurde. Gewaltige Steinquadermauern, Säulen und ein wehrhafter Turm, gebaut wie für die Ewigkeit, trotzend den Naturgewalten und der modernen Luftverschmutzung.
Ein Teil der Passagiere hatte die gewaltigen Schleusen besichtigt, ein anderer Teil war hinaus nach San Blas zu den Cuna-Indianern geflogen, und sie alle kamen voller Begeisterung zurück, beladen mit Andenken und Eindrücken, mit Foto- und Filmaufnahmen und Postkarten. Welcher normale Mensch kommt schon zu den letzten Inselindianern von Panama?
Nur Ludwig Moor hatte sich geärgert. Auch wenn er von seinem Onkel die Reise und ein dazugehörendes gutes Bankkonto geerbt hatte, änderte das nichts an seinem deutschen Beamtendenken.
Er drückte das so aus:
»Es ist eine unerhörte Frechheit, daß diese Indianer sofort losschreien, wenn man die Kamera hebt: ›One Dollar, please! One Dollar!‹ Und wenn man diesen Dollar nicht zahlt, drohen sie sogar mit der Faust. Ja, wo kommen wir denn da hin? Diese Kommerzialisierung bei den Naturvölkern! Und diese Preise bei den Molas, den bunten Flickentüchern! So'n Ding, 40 x 50 cm groß, soll zwölf Dollar kosten! Zwölf Dollar! Das ist doch Wucher! Das ist ein Ausnehmen der Besucher! Aber man kennt das ja aus Europa. Da steht den ganzen Tag über ein Bettler an der Ecke, und abends, nach Geschäftsschluß, geht er zum Parkplatz und steigt in seinen Mercedes. Überall das gleiche! Nee, bei mir nicht.«
Verbissen wanderte er am nächsten Morgen um acht Uhr früh wieder seine tausend Meter über das Promenadendeck.
Selbst Ewald Dabrowski hatte einen Ausflug nach Panama mitgemacht. Geführt von seiner Pflegerin Beate, den weißen Stock immer etwas vorgestreckt, tastend und unsicher auf unbekanntem Boden, ging er langsam in der Omnibusgruppe mit und ließ sich von Beate erklären, was zu sehen war. Welches innere Bild er sich von diesen Eindrücken machte, wußte keiner, aber jeder im Bus fand es bemerkenswert, daß ein Blinder so intensiv am täglichen Leben teilnahm.
Dabrowski sah mehr als die anderen. Vor dem Blinden braucht man sich nicht zu verstecken. Das dachten auch Erna Schwarme und François de Angeli, die sich von der Gruppe
Weitere Kostenlose Bücher