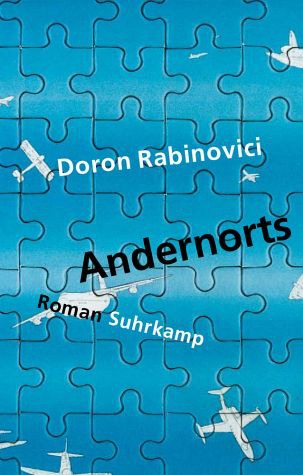![Rabinovici, Doron]()
Rabinovici, Doron
Stadt
sei. Er wolle Israeli werden. Noa meinte, es knirschen zu hören. Eine
Verspannung im Raum. Während Felix und Dina ein freudiges Gesicht machten, sah
sie, wie es Ethan forttrieb.
Er habe einen neuen Artikel
über Dov geschrieben, der in der Wochenendbeilage jener österreichischen
Zeitung erscheinen werde, in der auch sein Nachruf veröffentlicht worden war.
Diesmal sei es ein Porträt geworden. Felix klatschte in die Hände. Dina nickte
zufrieden. Noa und Ethan fragten, ob sie es lesen dürften. Rudi reichte ihnen
das Papier. Es war als Lobeshymne gedacht. Hatte Rudi damals durchblicken
lassen, Dov letztlich für seinen Zionismus zu verurteilen, verteidigte er nun
den Anspruch auf das verheißene Land. Er feierte Dov dafür, daß er kein Opfer
mehr sein wollte, sondern ein freier Mensch. Im Grunde war Dov wieder als
radikaler Nationalist dargestellt, nur wurde es diesmal anders bewertet.
Noch habe er den Artikel nicht
nach Wien geschickt. Ob die anderen ihn nicht auch lesen wollten. Er würde
gerne wissen, was sie davon hielten, wolle ihre Kritik hören. Felix winkte ab:
»Ich bin kein Zensor. Du hast das sicher wunderbar gemacht. Ich vertraue dir
voll und ganz.«
Noa und Ethan wechselten
Blicke. Rudi sagte: »Ich danke dir, Felix.« Er überging das Schweigen der
anderen. »Reden wir nicht mehr darüber. Ich bitte euch. Meine frühere Fassung
tut mir leid.« Er lächelte in die Runde: »Ich habe einen Plan.« Er habe über
alles nachgedacht. Er bitte Felix, ihn, den Sohn, als Organspender zu akzeptieren.
Es wäre wichtig für ihn.
Dina schaute erschrocken zu
Felix, dessen Lächeln zerronnen war. Er sprach ausdrücklich freundlich und
langsam. »Ich danke dir, aber das kommt überhaupt nicht in Frage!«
»Warum denn nicht?« fragte
Rudi.
»Allein die Idee ist pervers.
Soll der Sohn sich etwa für den Vater opfern?« Er griff sich ans Kreuz, als
meldeten sich die Schmerzen wieder.
»Warum denn nicht? Was heißt
hier überhaupt Opfer? Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Laß mich das
tun. Wieso lehnst du mich ab?«
»Du hast das Leben vor dir,
Rudi. Du brauchst deine Nieren noch. Ich kann dich doch nicht ausweiden.«
Dina war flatterig geworden.
Felix sagte, er verbiete, als Vater, jede weitere Diskussion darüber. Das sei
ihm fremd. Es war dieses Wort, das Rudi aufbrachte. Fremd.
»Bin ich dir also fremd?«
»Nicht du!«
»Soso!«
Ethan meinte: »Hör zu. Ich
habe eine bessere Idee.« Rudi schrie: »Du bist natürlich auch dagegen.«
»Wieso natürlich?«
»Weil du es bisher nicht
vorgeschlagen hast. Deshalb willst du auch nicht, daß ich es mache.«
Ethan schüttelte den Kopf. »Du
bist ja nicht normal.« Er atmete durch. »Ich glaube, es gibt einen einfacheren
Weg. Ich traf vor kurzem den berühmten Rabbi Jeschajahu Berkowitsch. Ihr habt
von ihm sicher schon gelesen. Kurz und gut: Er ist mir einen Gefallen schuldig.
Wenn Rabbi Berkowitsch will, findet er einen Menschen im Alter von Felix oder
älter, der ein passendes Organ für Abba spenden könnte. Glaubt mir.«
»Und warum soll er
ausgerechnet uns helfen?« fragte Rudi.
»Weil er von mir überzeugt
ist.« Er würde ihm bei Gelegenheit alles genauer erzählen.
Später saßen sie zu zweit im
ehemaligen Kinderzimmer, und Ethan berichtete von Rabbi Berkowitsch und seinem
Plan, den Messias zu erschaffen. Rudi sagte: »Das klingt doch vollkommen
verrückt.«
»Zweifellos, aber wenn wir so
zu einer Niere kommen!«
»Und wenn nicht?«
»Dann können wir immer noch
sehen, ob nicht einer von uns einspringt und sich für eine Transplantation zur
Verfügung stellt. Aber vielleicht weiß Berkowitsch einen Ausweg. Klar, es klingt
verrückt. Aber was ist noch normal? Der Wahnsinn ist bei uns doch längst schon
die Regel.«
Und auf dieses Argument wußte
auch Rudi nichts zu erwidern.
7
Blödsinn, sagte die
Medizinerin. Sie sei keineswegs von der Idee des Rabbiners Berkowitsch überzeugt.
Sie sei überhaupt nicht religiös. Sie mache ihre Arbeit, egal ob der Messias
durch ihre Hilfe auf die Welt komme oder, was sie eher erwarte, ein anderer
Schreihals. Im übrigen sei es nach heutigem Stand der Forschung gar nicht möglich,
den Klon eines ermordeten Embryos zu generieren. Eine solche Nachgeburt der
Shoah entstehen zu lassen sei ja an sich eine unappetitliche Vorstellung. »Aber
bitte! Ich erfülle meine Pflicht.«
Die Ärztin - blitzblaue Augen,
aschschwarzes Haar, von eisgrauen Fäden durchzogen, karamelbrauner Teint - sah
die
Weitere Kostenlose Bücher