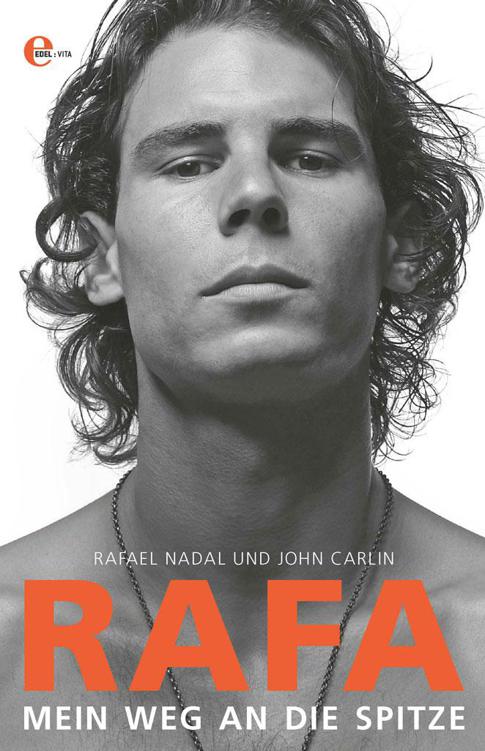![RAFA: Mein Weg an die Spitze (German Edition)]()
RAFA: Mein Weg an die Spitze (German Edition)
Bis dahin war ich es sowohl im Tennis als auch im mallorquinischen Juniorenfußball gewohnt, immer der junge Spund zu sein, der die Tollkühnheit besaß, es mit den Älteren aufzunehmen und sie zu schlagen. Nun besiegte dieser jüngere Bursche mich, und selbst wenn ich gewann, sorgte er dafür, dass es ein zähes Ringen war. Vermutlich würde Federer sich vor mir aus dem aktiven Tennissport zurückziehen, sofern ich nicht verletzungsbedingt aufgeben müsste. Aber Djokovic würde mir bis zum Ende meiner Tenniskarriere auf den Fersen bleiben und alles daransetzen, mich in der Weltrangliste zu verdrängen.
Auf Sand war ich ihm ebenso überlegen wie Federer und allen anderen. Aber auf Hartplätzen hatte ich gegen ihn wie auch gegen viele andere hart zu kämpfen. Auf diesen Bodenbelägen bereitete es mir die größten Mühen, mich anzupassen. Auf den schnelleren Bodenbelägen gelang mir der nötige Sprung nach vorn nicht, und so machte ich kaum Fortschritte in Australien und noch weniger in dem für mich schwierigsten Grand-Slam-Turnier, den US Open. Ich bin nie zufrieden, will immer mehr erreichen oder zumindest bis an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit gehen.
Mittlerweile verdiente ich mehr Geld, als ich mir je hätte träumen lassen, aber es kam mir nie in den Sinn, mir eine Wohnung in Monte Carlo, Miami oder auch Mallorca zu kaufen. Ich war mehr als zufrieden, weiter im Haus meiner Eltern zu leben. Das hatte allerdings nichts mit Sparsamkeit zu tun. Ich träumte von einem eigenen Boot in Porto Cristo. Und gelegentlich dachte ich daran, mir einen schicken Wagen zu kaufen, eine Fantasie, die im Juni 2008 bei den French Open Gestalt annahm.
Als ich mit meinem Vater durch den Ort schlenderte, kamen wir an einer Autohandlung für Luxussportwagen vorbei. Ich schaute durchs Fenster, sah dieses herrliche Fahrzeug und sagte zu meinem Vater: »Weißt du was? Ich glaube, so einen würde ich mir gern kaufen.« Mein Vater schaute mich an, als ob ich verrückt geworden wäre. Ich verstand seine Reaktion. Damit hatte ich gerechnet. Es stand zwar nirgendwo geschrieben, aber ich wusste ebenso gut wie er, dass der Rest meiner Familie und unsere Nachbarn in Manacor – und auch mein Vater – es vulgär und protzig finden würden, ein solches Auto zu besitzen. Ich kam mir ein bisschen dumm vor. Aber im tiefsten Inneren wollte ich dieses Gefährt trotzdem haben. Hätte mein Vater »nein, auf keinen Fall«, gesagt, wäre die Idee sofort für mich gestorben. Ohne seine Zustimmung hätte ich den Wagen nicht gekauft. Aber er schlug einen Kompromiss vor, den er für eine schlaue List hielt: »Hör zu, wenn du in diesem Jahr Wimbledon gewinnst, kannst du dir so einen Wagen zulegen. Was hältst du davon?« Ich antwortete: »Wie wäre es, wenn ich diese Woche hier in Paris die French Open gewinnen würde?« Grinsend sagte er: »Nein, nein. Gewinne Wimbledon, dann kannst du ihn kaufen.« Mir war völlig klar, dass seine verschlagene Antwort aus der Überzeugung entstand, Wimbledon sei in diesem Jahr für mich außer Reichweite. Er glaubte nicht, dass er diese Wette verlieren könnte. Einen Monat später, zu Anfang des letzten Satzes auf dem Centre Court in Wimbledon, war diese Abmachung für mich nur ein weiterer Anreiz, Federer zu schlagen und das Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, das bei allen Spielern das höchste Ansehen genoss.
So ruhig ich auch, trotz der offenkundig vorhandenen Nervosität, zu sein glaubte, bekleckerte ich mich beim ersten Ballwechsel des Satzes, bei dem Federer Aufschlag hatte, nicht gerade mit Ruhm. Nach einem schnellen Ballwechsel zwang ich ihn zu einer verpatzten Rückhand, die vom Rand seines Schlägers abprallte und es knapp über das Netz schaffte. Statt einen Gewinnschlag zu versuchen, entschied ich mich für einen Stoppball. Dies macht man, wenn es keine Alternative gibt oder wenn man sieht, dass der Gegner weit hinten steht und kaum eine Chance hat, den Ball zu erreichen. Mitunter entscheidet man sich aber auch für einen Stoppball, weil man nervös ist, der Ball etwas zu schwierig erscheint, um ihn vernünftig zu handhaben, und man nicht wagt, ihn kraftvoll zu spielen. So war es bei mir. Hinter diesem Schlag stand ein bisschen Feigheit. Er erreichte den Ball gerade noch gut genug, um einen Lob auf meine Rückhandseite zu spielen. Ich reckte mich hoch, um ihn zu erreichen, und schlug ihn ins Aus. Ein schlechter Start.
Es war wichtig, Federer nicht in dem scheinbaren Eindruck zu bestärken, dass ich
Weitere Kostenlose Bücher