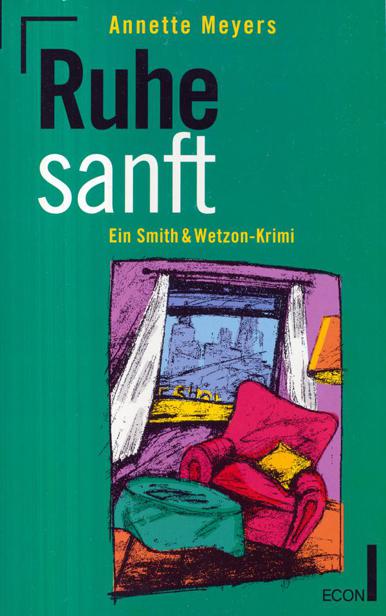![Ruhe Sanft]()
Ruhe Sanft
Zeitungen oder alten Teppichen und Handtüchern vergraben; manche hatten sogar Decken. Der ganze Bereich roch ekelhaft. Pendler strömten ohne Unterbrechung in beide Richtungen durch den Tunnel, den Blick abgewandt, die Augen verschließend.
Diantha blieb in einer Bucht stehen, wo ein Durchgang zum eigentlichen Grand Central abzweigte. »Wir müssen unbedingt reden, aber nicht hier und nicht jetzt.« Sie blickte Wetzon eindringlich an.
Ein Mann mit hochgezogenen Schultern und verfilzten Haarsträhnen schob sich mit einem schmutzigen Hut in der Hand vor. »Haben Sie ein bißchen Kleingeld übrig?« schmeichelte der Stadtstreicher. Er steckte seinen Hut vor. Diantha zog ein paar Münzen aus der Tasche ihres pelzgefütterten Regenmantels und ließ sie in den Hut fallen. »Danke, Schwester, danke.«
»Ich bin nicht deine Schwester«, zischte sie und sah ihn wütend an. Der Mann kroch zurück in den Haupttunnel.
Wetzon verlor die Geduld. Sie war es müde, vor irgend etwas wegzulaufen, das sie nicht verstand, müde, nett und hilfsbereit zu sein. »Hätten Sie was dagegen, mir einen Hinweis zu geben?«
Diantha überging Wetzons Frage und stellte statt dessen selbst eine, während sie nervös den Tunnel auf und ab spähte und die nach Hause eilenden Menschenmengen musterte. »Wer waren diese Männer? Polizisten?«
»Sie sagten, sie seien vom FBI.« Wetzon sprach die Worte aus, aber sie konnte sie einfach nicht glauben.
Dianthas Gesicht verfinsterte sich. Schweißperlen glänzten auf ihrer Oberlippe. »Wir können hier kein Risiko eingehen. Erst einmal müssen wir sie abschütteln.«
»Das haben wir doch.«
»Ich würde mich nicht darauf verlassen. Sie sind überall, wer immer sie sind.« Ihr Mund zuckte. »Wir müssen uns trennen. Ich bin zu groß. Sie haben mich mit Ihnen gesehen, sie suchen nach mir. Ich rage aus der Menge heraus. Und sie werden uns beide suchen.« Sie legte ihre Hand auf Wetzons Schultern und drückte sie fest.
Wetzon trat beiseite, als wolle sie gehen, und Diantha ließ die Hand fallen. »Ich glaube, es ist höchste Zeit, daß Sie mir sagen, was das soll.«
»Da sind sie! Verdammt!« Dianthas Blick war verstört. Sie griff in ihre Tasche. Einen Moment lang dachte Wetzon voller Panik, Diantha würde eine Waffe ziehen, aber sie hatte nur ein Taschentuch in der Hand, mit dem sie sich das Gesicht abtupfte.
»Wo?«
»Bitte! Ich flehe Sie an. Es geht um Leben und Tod.« Diantha griff in ihre Handtasche, eine braune Ledertasche fast so groß wie ein Aktenkoffer, und nahm einen Schlüssel aus einer roten ledernen Geldbörse. »Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden sehen und verstehen, warum ich das tu und warum auf diese Art.« Sie drückte den Schlüssel in Wetzons Hand und schloß ihre Finger darüber. »Sechs neunzehn East 16. Street. Ein Sandsteinhaus. Klingeln Sie bei mir. Zweimal kurz und einmal lang. Dann bis zehn zählen und das gleiche noch mal. Dann gehen Sie hinein.« Sie drängte Wetzon mit einem leichten Schubs vorwärts. »Ich kehre um und nehme die Bahn an der Lexington. Ich treffe Sie dort, so schnell ich kann.«
»Aber was hat das alles mit mir zu tun?« Wetzon war völlig verwirrt. In diesem Augenblick sah sie einen großen Mann im Trenchcoat, der aus den normalen Subway-Passagieren herausragte. Er hielt nach jemandem Ausschau, suchte die Gesichter in der Menge ab. Als Diantha sie diesmal zerrte, folgte sie bereitwillig. Sie mischten sich unter den Strom der Leute, die zum Pendelzug eilten.
»Bitte«, sagte Diantha. »Lassen Sie sich durch nichts schrecken, was Sie dort sehen...« Sie ging schneller und zog Wetzon hinter sich her. »Wenn wir in das Gewühl an den Drehkreuzen kommen, gehen Sie einfach mit der Menge und nehmen den Pendler zur BMT, dann die BMT zur 14. Ich gehe jetzt.«
Wetzon nickte. Ihre Hände waren kalt. Sie nahm die Handschuhe aus der Tasche und zog sie an, wobei sie den Schlüssel in der rechten Hand unter dem Handschuh behielt.
Hier drängten sich die Menschen dicht an dicht, schoben und stießen, um von beiden Seiten, vom und zum Pendelzug, durch die Drehkreuze zu kommen. Es erschien Wetzon so dumm, daß es nicht genügend Türen gab, um die Massen vom Pendelzug durchzulassen, weil der Verkehrsbetrieb es für angebracht hielt, die Hälfte der Türen mit Ketten zu sperren, um zu verhindern, daß Schwarzfahrer hineinschlüpften. Sie wandte sich einmal nach Diantha um, entdeckte sie, wie sie den Turban abnahm,
Weitere Kostenlose Bücher