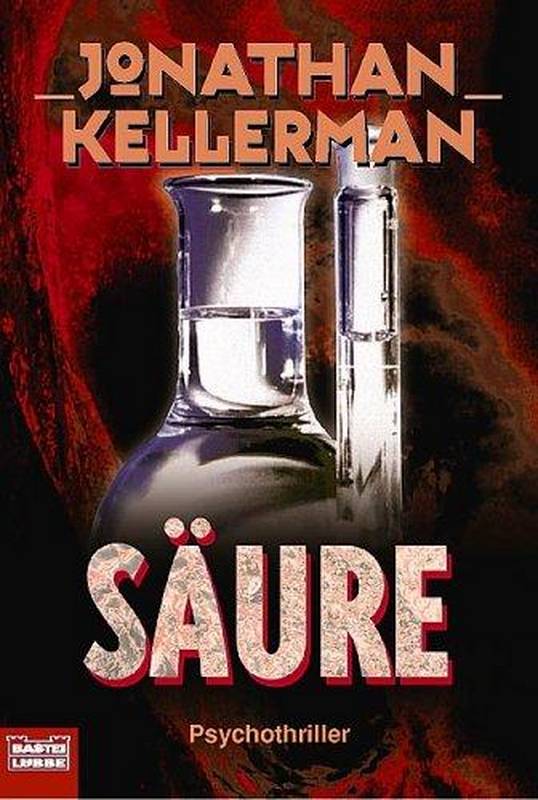![SÄURE]()
SÄURE
ihre Lage, aber ich muß trotzdem irgendwann mit ihr reden, wenn… wenn sie möchte, daß ich Melissa behandle.«
»Dr. Delaware, bitte, das ist ganz - Sie dürfen die Behandlung des Kindes nicht aufgeben. Es ist ein so gutes, kluges kleines Mädchen. Es wäre jammerschade, wenn sie…«
»Wenn was?«
»Bitte, Doktor!«
»Ich übe mich in Geduld, Mr. Dutchy, aber es fällt mir wirklich schwer zu verstehen, was da so ungeheuer problematisch ist. Ich verlange von Mrs. Dickinson nicht, daß sie aus dem Haus gehen soll, ich möchte ja nur mit ihr reden. Ich begreife ihre Situation, ich bin der Sache nachgegangen. Der 3. März 1969. Hat sie auch eine Phobie gegenüber dem Telefon?«
Dutchy schweigt zunächst, schließlich gesteht er: »Gegenüber Ärzten. Sie hat so viele Operationen hinter sich und hat solche Schmerzen aushalten müssen. Man hat sie immer wieder wie ein Puzzlespiel zerlegt und wieder zusammengesetzt. Ich will nichts Nachteiliges über die Ärzte sagen. Ihr Chirurg war ein Zauberer, er hat sie fast wiederhergestellt. Aber in ihrem Innern - sie braucht Zeit, Dr. Delaware. Lassen Sie mir Zeit. Ich werde ihr zu verstehen geben, wie lebensnotwendig es ist, daß sie mit Ihnen in Kontakt tritt. Aber bitte haben Sie Geduld, Sir.«
Jetzt war es an mir zu seufzen.
Er erklärte: »Sie ist nicht ohne Einsicht, was die Situation anbelangt. Aber nach dem, was die Frau durchgemacht hat…«
»Sie hat Angst vor Ärzten«, sagte ich, »und trotzdem hat sie Dr. Wagner empfangen.«
»Ja«, bestätigte er, »das war eine Überraschung. Sie wird nicht so gut mit Überraschungen fertig.«
»Wollen Sie damit sagen, daß es bei ihr nach dem Gespräch mit Dr. Wagner zu einer negativen Reaktion gekommen ist?«
»Sagen wir, es war nicht leicht für sie.«
»Aber sie hat es getan, Mr. Dutchy - und es überlebt! Das könnte an und für sich therapeutisch von Nutzen sein.«
»Doktor -«
»Ist es, weil ich ein Mann bin? Würde sie besser mit einer Therapeutin reden können?«
»Nein,« sagte er, »absolut nicht! Das ist überhaupt nicht der Fall.«
»Einfach Ärzte im allgemeinen«, folgerte ich, »jedweden Geschlechts.«
»Das ist richtig, bitte, Dr. Delaware«, seine Stimme war sanfter geworden, »bitte haben Sie Geduld.«
»Also gut, aber erst einmal muß mir jemand die Fakten mitteilen, die Einzelheiten, Melissas Entwicklungsgeschichte und die Familienstruktur.«
»Sie halten das für absolut notwendig?«
»Ja, und es muß bald sein.«
»Also gut«, sagte er, »ich werde es Ihnen sagen, soweit ich kann.«
»Was heißt das?« fragte ich.
»Nichts - überhaupt nichts, ich werde Ihnen die ganze Geschichte erzählen.«
»Morgen mittag«, schlug ich vor. »Wir treffen uns zum Lunch.«
»Ich nehme gewöhnlich keinen Lunch zu mir, Doktor.«
»Dann werden Sie mir zusehen, wie ich esse, Mr. Dutchy. Sie werden sowieso das meiste reden.«
Ich suchte ein Restaurant auf halbem Weg zwischen der Westside und seiner Gegend aus, eines, das ich für hinreichend konservativ hielt, um seinem Geschmack entgegenzukommen: den Pacific Dining Car an der Sechsten Straße, nahe Witmer, ein paar Blocks westlich vom Stadtzentrum gedämpfte Beleuchtung, glänzend polierte Mahagonitäfelung, rotes Leder und Leinenservietten. Die meisten Besucher waren Finanzleute, Anwälte großer Firmen und politische Kulissenschieber, die dort ihre dicken Steaks aßen, Baugenehmigungen aushandelten und sich über Sport sowie Angebot und Nachfrage unterhielten.
Dutchy war schon vor mir da und erwartete mich in einer Nische im rückwärtigen Teil. Er trug denselben blauen Anzug oder ein Duplikat. Als ich auf ihn zukam, erhob er sich leicht und verbeugte sich höflich.
Ich setzte mich, rief den Kellner und bestellte einen Olivas pur. Dutchy bestellte einen Tee. Wir warteten schweigend auf die Getränke. Trotz seines frostigen Betragens sah er verloren und etwas bemitleidenswert aus - ein Mann des 19. Jahrhunderts, den es in eine ferne, vulgäre, für ihn unverständliche Zukunft verschlagen hatte.
Meine Wut war inzwischen verraucht, und ich hatte mir geschworen, jede Konfrontation zu meiden. So erklärte ich ihm schließlich, wie sehr ich es zu schätzen wüßte, daß er sich die Zeit nahm, mit mir zu sprechen. Er sagte nichts, wobei er mich sehr unglücklich anblickte. Small talk war offensichtlich nicht angebracht. Ich fragte mich, ob ihn jemals irgend jemand schon mit seinem Vornamen angeredet hatte.
Der Kellner brachte die Getränke. Dutchy
Weitere Kostenlose Bücher